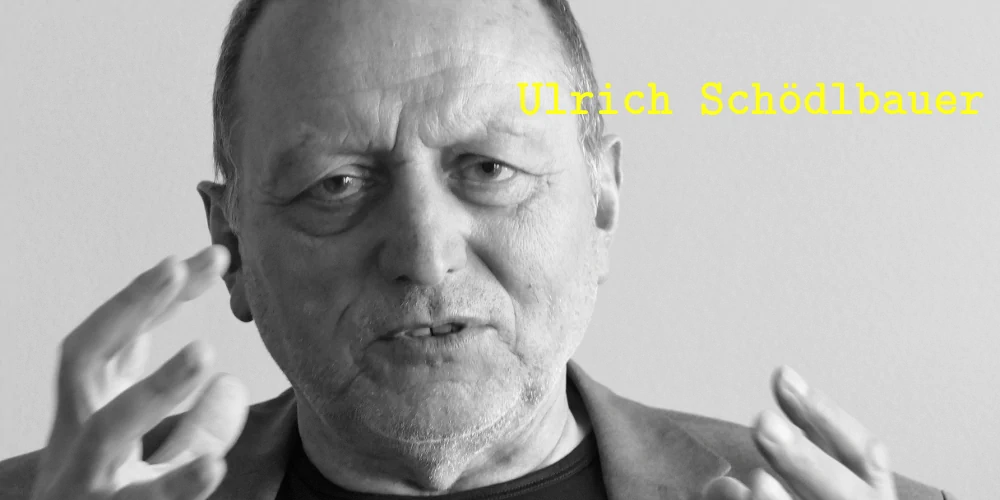Personen und Handlung sind frei erfunden.
Boat people nannte man Bürger der ehemaligen Republik Vietnam und Kambodschas, die nach dem Sieg des kommunistischen Nordvietnam am dreißigsten April 1975 in hochseeuntauglichen Booten aufs Meer flohen, um in eines der Länder Südostasiens (und weiter in die USA) zu gelangen.
Die ›Organisation‹ hat es nie gegeben. – U.S.
1
Jeder weiß, dass der siebzehnte Breitengrad für eine dramatische Reihe von Jahren die Grenze zwischen der Demokratischen Republik Vietnam (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, kurz DRV oder Nordvietnam) und der Republik Vietnam (Việt Nam Cộng Hòa oder Südvietnam) markierte. Kaum bekannt sein dürfte die Tatsache, dass Fac ten Chek nur wenige Kilometer nördlich der Demarkationslinie geboren wurde und dort, wie andere Kinder seines Alters, die Schule besuchte. Biographiefreunde könnten darin einen Mangel erblicken und Abhilfe verlangen – zu Unrecht: bis zur Übernahme eines bestimmten Postens ist Fac ten Cheks Leben und Wirken völlig bedeutungslos. Zweifellos liegt darin eine gewisse Herausforderung.
Fac ten Chek, Sohn eines Kleinfunktionärs, galt als hochbegabt.
Wer die Archive bemüht und genügend Parteichinesisch beherrscht, dem werden seine Studienjahre an der Parteihochschule auch ohne persönliche Zeugnisse schnell zu einem offenen Buch, in dem sich bequem vor- und zurückblättern lässt. Abgesehen vom Furor der Bombennächte, den Säuberungen, der Versorgungsmisere und einem notorischen Mangel an Wohnraum verlief das Leben in Hanoi monoton. Fac ten Chek muss über beide Ohren im Examen gesteckt haben, als ihn die Einberufung ereilte. Das war im Frühjahr ’75, als die Panzerarmee des Genossen Dung dem verhassten Regime des Südens den längst erwarteten Todesstoß versetzte.
Wir treffen hier erstmals auf das Paradox, dass für den Beteiligten gerade das Überraschende weitgehend überraschungsfrei ist, es sei denn, er lässt sich von Äußerlichkeiten blenden oder erliegt der alltäglichen Propaganda.
Inzwischen gilt der Sozialismus als eine Epoche der Wunder: animistische, selbst totemistische Praktiken waren an der Tagesordnung. Dank ihrer ging das Leben zwischen Machtkämpfen seinen Gang, die jeden jederzeit zermalmen konnten, gleichgültig, welche Verdienste er sich erworben hatte und welchen Rang er gerade bekleidete. Zu den verbreiteten Praktiken zählte der Reliquienkult. Zum Beispiel kursierten in den höheren Parteizirkeln kleine, handsignierte Mao-Bibeln in solcher Zahl, dass die Lebenszeit des Großes Steuermanns mehrfach in den dafür benötigten Signierstunden Platz gefunden hätte.
Eines dieser Exemplare steckte in Fac ten Cheks Tornister, als er gegen den südlichen Aggressor ins Feld zog. Er durfte es nicht sein eigen nennen, denn Eigentum bedeutete Parteiausschluss und in härteren Fällen die Todesstrafe.
2
Am Tag der Befreiung stand Fac ten Chek, angetan mit der Uniform eines Offiziers der Volksbefreiungsarmee, auf den Resten der Zitadelle von Saigon, wies, die Augen vor Eifer gerötet, mit ausgestrecktem Arm auf einen überaus hässlichen, von der US Army soeben verlassenen Flachbau, in dem einige Tonnen ungetesteter toxischer Substanzen noch darauf warteten, den kommunistischen Norden Mores zu lehren, und brüllte die geflügelten Worte: »Von hier und heute wird eine neue Epoche der Weltgeschichte ausgehen.« Der Satz brachte ihm zehn Jahre Einzelhaft, die Aberkennung mehrerer Orden sowie die Erkenntnis ein, dass nicht alles gesagt zu werden verdient, was es verdient, gesagt zu werden. Heute weiß man, dass Einsichten dieses Kalibers in jenen Jahren eine überaus hohe Bedeutung zukam, insofern sie die Zeit im Umerziehungslager auf ein überschaubares Maß verkürzten.
Kann man behaupten, dass er das Lager als gebrochener Mann verließ? Man kann und man kann es nicht. Zu fragen wäre, ob er es überhaupt je verließ.
Verließ er es je?
Gute Frage.
Gewiss hätte sie eine Antwort verdient, aber so läuft das nicht. Genauso ließe sich fragen, ob er, die physische Anwesenheit abgerechnet, jemals im Lager angekommen war – ein junger Mann, traumatisiert, mit abgebrochenem Examen, erfüllt von Todesmut und Feindeshass, von Stolz, frisch erworbenem Schneid und den üblichen Alltagsängsten. Das Lager, sagen diejenigen, die es durchlaufen und überlebt haben, ist die härteste aller Schulen. Es zerbricht dich und manchen schmiedet es neu. Diejenigen, die es nicht zu durchlaufen brauchten und auch überlebt haben – also die Leute –, verweisen auf die erfreulich hohe Zahl erfolgreicher Resozialisierungen und nennen es eine Wohltat für alle, die es durchlaufen durften.
Auf die prägenden Erfahrungen eines Menschen ist im allgemeinen Verlass. Sie begleiten ihn in den dunkelsten Stunden seines Lebens wie in seinen hellsten, sie sind zur Hand, wenn er sie braucht, sie heften sich an seine Fersen, wenn er sie nicht braucht, und bei Gelegenheit schnappen sie zu.
3
Jeder Mensch, sollte man annehmen, verfügt über ein Zuhause. Doch auch hier sind Ausnahmen die Regel. Eine bleiche Bürokratenhand hatte Fac ten Cheks Vater – verständlicherweise, bedenkt man die Schande, die der Sohn über sein Haus gebracht hatte – die keineswegs üppige Pension gestrichen. Wie lebt es sich mittellos im Land der Besitzlosen? Schlecht.
Fac ten Chek fand ihn, dank freundlicher, wenngleich überaus zurückhaltender Nachbarn, in einem Schuppen am Stadtrand.
Das ist nicht verbürgt, aber es ergibt sich aus der Logik der Sache.
Der Alte tat, was er sein Leben lang getan hatte: er starrte Löcher in die Luft. Einst im Dienst hatte er sie in die Augen der ihm unterstellten Genossen gebrannt.
Das ist eine ungesicherte Hypothese.
Jedenfalls glaubte es der zurückgekehrte Sohn, wenngleich er sich nicht sicher war und wusste, dass nur zählt, was sicher geglaubt wird.
Ungeachtet seines Glaubensproblems übte sich Fac ten Chek in Geduld – der einzigen Sohnestugend, die er gelernt hatte. Von Zeit zu Zeit klopfte der Alte mit einem Stöckchen auf den Boden und stieß ein Grunzen aus, in dem sich womöglich ein Fluch verbarg. Fac ten Chek hockte auf dem Boden, bohrte drei Finger der rechten Hand in Kinn und Wange und schwieg. Er fühlte die lange Tradition des Schweigens, die sein Land oft gerettet hatte und es jetzt in den Untergang führte. Er hasste sie aus vollem Herzen und unterwarf sich ihr willig.
Nach Ablauf der vorgeschriebenen Stunden erhob er sich, verneigte sich höflich, ließ ein paar Münzen in einen Becher fallen, schob den Fetzen über dem Eingang zur Seite, glitt hinaus in die Nachtluft, atmete tief durch und lief in die Reisfelder. Nicht verbürgt ist, dass der Vater seinen Abgang bemerkte. Warum auch? Er war ein Bettler, der Klang der Münze verriet Fac ten Chek sein Geheimnis. Betteln war verboten, also konnte er ebensowenig Bettler wie Vater sein. Was dann? Ein Gespenst? Auch Gespenster waren verboten, streng verboten, es gab kaum noch welche, sicher gehörte er nicht dazu.
Fac ten Chek wurde vom Gelände verschluckt und wiedergefunden.
Mittag war’s und unerträglich die Hitze –
da geschah’s, dass ein radelnder Milizionär, von Grunzlauten aufgeschreckt, abseits der Straße den von niemandem Vermissten entdeckte und der Gemeinschaft zurückgab, indem er ihn beim nächsten Polizeiposten ablieferte. Für den Milizionär sprang ein karges Lob heraus, dann verlor sich seine Figur aufs Neue in den Nebeln der geschichtslosen Welt, die neben der Welt der Geschichte existiert und sie mit Sicherheit überdauern wird, falls nicht das allzu Vorhersehbare eintritt und beide, gezielt oder nicht, mit einem Schlag auslöscht.
Wir verlassen den Bereich kombinatorischer Erkenntnis, vulgo Mutmaßung, und treten ein in den Glanz, den nur wirkliche Geschichte verströmt. Der Polizeioffizier, ein strammer Bursche, schien aus nicht weiter bekanntem Grund über die Identität des Eingelieferten im Bilde zu sein. Jedenfalls schob er Fac ten Chek, nachdem er seine Fingerabdrücke genommen, seine Länge, sein Gewicht, seine Bauch- und Kopfmaße festgestellt und mehrfach telefoniert hatte, ein Formular hin, das dieser schlaftrunken unterschrieb. Es war seine Ernennung.
4
Den Ausdruck boat people hatte Fac ten Chek, wie vieles andere, noch nie vernommen. Vermutlich ergeht es dem einen oder anderen heutigen Leser ähnlich, wenngleich aus Gründen, die unvergleichlich anders genannt werden müssten, wären sie nicht Gründe wie alle anderen auch. Jahrelang hatten Leute der ehemaligen Saigoner Society, von den neuen Machthabern das Schlimmste befürchtend, viel Geld hingeblättert, um sich in Fischerbooten, defekt oder nicht, nächtens aufs Meer hinausschaffen zu lassen – in der irrwitzigen Hoffnung, per Zufall von einem Hochseeschiff aufgelesen und in ein entferntes Land, am besten die USA, verfrachtet zu werden. Unempfindlich gegen das Wesen der Befreiung, hatten sie nicht abwarten wollen, dass man sie von ihrem bürgerlich-konterrevolutionären Wesen befreite, indem man sie in die Welt der Lager und Todeszellen zur Weiterbildung überstellte.
Die Regierung hatte das Treiben beobachtet, aber sich nicht dazu geäußert. Warum? Das ist leicht erklärt. Die Gehälter der Getreuen lagen unter dem Existenzminimum (wo immer das liegen mochte). Korruption galt als kapitalistisches Laster, das mit dem Sieg des Sozialismus aufgehört hatte zu existieren. Woher die Scheu? Hinter vorgehaltener Hand kursierte in den oberen Rängen der Partei die Überzeugung, Flucht sei ein Geschäft wie jedes andere und deswegen von Staats wegen zu organisieren. Der gemeine Flüchtling liebt das Leben und das Leben liebt ihn. Das entsprach einer Goldader, deren Ausbeutung sich leicht in den Rang einer vaterländischen Pflicht erheben ließ.
Die Ernennung zum Flüchtlingskoordinator verdankte Fac ten Chek dem Zufall, der Rivalität zweier Minister, der Feindschaft einer Konterrevolutionärin und einem Mithäftling, der inzwischen Karriere gemacht hatte.
So ein Satz schreibt sich gelassen hin und die geneigte Leserschaft vergisst dabei leicht, wieviel Recherche-Mühsal in ihm steckt. Trotzdem – rein als Aussage betrachtet, ist er blühender Unsinn. Nichts von alledem hätte gereicht, um das Unwahrscheinliche eintreten zu lassen, hätte nicht auch der Spruch existiert, den die Dorfhexe anlässlich Fac ten Cheks Geburt gemurmelt hatte, woraufhin die Miliz sie, nebst anderem menschlichem Gerümpel, auf einen Lastwagen schob und mit ihr davonfuhr.
Von diesem – ungesicherten – Spruch war während seiner Jugend häufig die Rede: hinter vorgehaltener Hand, versteht sich. Auf Zauberei stand die Todesstrafe. Keiner kannte den Wortlaut. Vielen galt er als geheim und sie bemühten sich nichts zu hören, wenn die Rede auf ihn kam. Doch ein paar Versionen zirkulierten in den örtlichen Parteikreisen, wurden zum Gegenstand lebhafter Vier-Augen-Gespräche und fanden den Weg in die Weiten des Apparats, der nie vergisst.
Am Tag der Ernennung fischte Fac ten Chek die Mao-Bibel aus dem Bücherregal, drückte das verlebte Büchlein flüchtig gegen Stirn und Mund und verbrannte es. Die Asche schob er zusammen und rührte sie in ein wenig Zement ein, mit dem er den Kaminboden bestrich. Eine sinnlose Geste: Er wusste, sie waren schon dagewesen und hatten jede Kleinigkeit registriert. Der Krieg zwischen China und Vietnam lag gerade einmal acht Jahre zurück – eine entsetzlich lange, eine entsetzlich kurze Zeit für einen, der wusste, dass es ab jetzt auf ihn ankam. Die Mao-Bibel hatten sie stehengelassen, um zum gegebenen Zeitpunkt etwas gegen ihn in der Hand zu haben. Jetzt hatten sie etwas gegen ihn in der Hand.
Fac ten Chek kannte das Büchlein auswendig. Es fiel ihm schwer, einmal Gelerntes zu vergessen. Andere gründeten darauf ihren Broterwerb. Die Menschen, zwischen denen er sich jetzt bewegte, vergaßen stets und vergaßen nie.
5
Jahrelang zählte Fac ten Chek zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der Welt. Der Öffentlichkeit blieb seine Existenz zur Gänze unbekannt. Unter seiner behutsamen Lenkung wuchs die Vietnamflucht zu einem blühenden Industriezweig heran, dessen Ausläufer sich bis nach Australien und Europa erstreckten. Die Gesprächspartner in New York und London, in Wien und Sydney schätzten seine eiserne Kompetenz und bewunderten an ihm, was sie für im Feuer interner Kämpfe gehärtete Disziplin hielten: die durch nichts und niemanden abzulenkende, sich keine Schwäche und keinen Ausrutscher leistende Sachlichkeit seiner Auftritte.
›Zu Gänze‹ klingt wesentlich vollmundiger, als die Sachlage es erlaubt. Sieht man näher hin, so besteht die breite Öffentlichkeit dort, wo sie besteht, also im sogenannten Westen, der sich bis vor kurzem noch die ›westliche Welt‹ nannte, aus Hunderten, vielleicht sogar Tausenden von Nischen unterschiedlichster Größe, teilweise praktisch durchlässig, teilweise nachlässig gegeneinander abgeschottet, manche von tiefen Schleiern gegen das neugierige Tageslicht abgeschirmt gleich Mysterienzirkeln, in denen, vor allem zu Wahlzeiten, Schwarze Messen gefeiert werden und weitgereiste Begattungskünstler ihren überaus schwierigen Part in Fruchtbarkeitsritualen meistern, die bis in die Frühzeit des Homo sapiens und weiter, viel weiter zurückreichen – vielleicht bis zu den Bienen, wer weiß. Vergebens hatte eine Hundertschaft von Prostituierten im Auftrag verschiedener Dienstleister, darunter die chinesische, sizilianische, brasilianische, libanesische, schottische sowie die New Yorker Mafia, sich im Laufe der Jahre Zugang zu Fac ten Cheks Hotelbetten zu verschaffen versucht. Was ihnen missriet, das gelang, gleichsam aus Versehen, einer Düsseldorfer Straßenhure auf Anhieb.
Was ist ein Fakt? Fakt ist, dass ein Mensch, sobald er eine gewisse Position erklimmt, ins Fadenkreuz der Faktensucher gerät, einer Klasse von Mitmenschen, denen kein Vorwand zu billig, kein Mittel zu schäbig, keine Hypothese zu gewagt und kein Aufwand zu absurd ist, um zu Einsichten zu gelangen, die sie entschlossen beiseiteschieben, wenn sich herausstellt, dass sie nicht den Gemeinten, sondern seinen Nächsten betreffen, der doch auch der ihre ist und, in Anbetracht aller Gleichheitsgrundsätze und der eigentümlichen Würde, die Zweibeinern im Universum anhaftet, den gleichen Anspruch darauf erheben könnte, in seinem Brunftverhalten bespitzelt, in seinem Erwerbsleben verdächtigt und in Toilettenfragen gnadenlos expropriiert zu werden. Fakt ist, dass sich zirka dreißig Geheimdienste im Hörbereich drängelten, als Fac ten Chek, wie stets inkognito reisend, entschlossen zur Kontaktaufnahme schritt.
»Hu’sät?« räusperte er sich. Um ein Gespräch in Gang zu bringen, wies er mit der linken Hand – die rechte hielt das Bierglas umklammert – auf das überlebensgroße, an den Ecken rissig gewordene Heinrich-Heine-Plakat, das die Wand hinter dem Tresen verzierte. Gleich beim Eintritt hatte er den Ehrenmarschall der Revolution erkannt. Zum Zweck ethnologischer Feldforschung zog er es vor, den Unwissenden zu mimen.
»Ach der«, lächelte die muntere Dame, »der hängt immer da. Lassen Sie sich nicht stören. Der hört nichts.«
Eine warme Welle durchlief Fac ten Chek. Er nahm seinen Mut zusammen und lächelte zurück. Flott leerte er das Glas, er brannte vor Unrast. Die ungewohnte Muskelspannung übertrug sich direkt auf den Magen. Der nahende Zusammenbruch der Sowjetunion ließ ihn redselig werden.
»Russki?« grunzte er, den Blick stier aufs Bierglas gerichtet.
»Nee, Ukraine. We hate Russians.«
»Aber ihr seid Russen!«
Das Lächeln erlosch. Die Dame hämmerte ihren Zigarettenrest in den Aschenbecher und Fac ten Chek begriff, dass nur ein Schein sowie die Erwartung weiterer seine Enttarnung hinauszögern konnten.
Beherzt griff er in die Tasche.
6
Als die große Sowjetunion sich ins Schwert stürzte, um als Mütterchen Russland im Kreise ihrer unwilligen Küken wieder aufzuerstehen, trieb Fac ten Chek auf einem mit Flüchtlingen überfüllten Fischerboot in den Weiten des Pazifischen Ozeans. Das Geschäft mit den boat people neigte sich dem Ende zu. Im Büro hatte er die Zurücknahmepapiere für verdiente Genossen unterschrieben, die in den westwärts hastenden Ländern Ost- und Mitteleuropas ausharrten, vom Lynchpöbel bedroht und von jederlei Einkünften abgeschnitten. Die ukrainische Nacht waberte in seinen Hirnwindungen und zeitigte Einfälle, die ihn, falls er sie laut werden ließ, mit erheblicher Sicherheit vors Erschießungskommando brachten. Das allein wäre zu verkraften gewesen, doch der Gedanke, sein Nachfolger könnte wenig später durch sie zu Ministerwürden aufsteigen, ließ seinen Enthusiasmus erkalten. Alles war, wie er sich vorzusagen nicht müde wurde, eine Frage des Timing. Anglizismen wie dieser ließen sich nicht länger vermeiden, wollte man in einer Welt des Umbruchs bestehen. Worin bestand ihre einzigartige Wirkung? Sie passten in jede Hand – wie jede andere griff auch seine danach, sobald Verständigung in kulturelle Tiefen abzusinken drohte, die nicht jedermann zugänglich und unter Geschäftsleuten so gut wie tabu waren.
Sein Name, er registrierte es mit Befremden, hatte sich in den Fernsehanstalten des Westens eingenistet und trieb mit den Zuschauern Schabernack.
7
Wer bist du, fragte er sich, die Augen beschattend und die Weiten des Weltmeers nach einem Anzeichen menschlicher Gegenwart absuchend gleich hunderten Augenpaaren vor, neben und hinter ihm – wer bist du, dass du für diese Menschen Schicksal spielst, etwas, das in keinem Fünfjahresplan vorgesehen ist und in keiner Modernisierungsbilanz jemals auftauchen wird? Er hatte genügend Menschen krepieren gesehen, um dem Untergang dieser Auswanderer, die sich an die Fiktion des Verfolgtseins wie an einen Strohhalm klammerten, während sie bereitwillig exakt die Rolle übernahmen, die das Politbüro ihnen zugedacht hatte, gelassen beizuwohnen, selbst wenn er dabei in Gefahr geriet.
Das Wort ›Schicksal‹ hatte es ihm angetan. Er hatte es in alten Schriften gefunden und unter Mühen seine Verwendungsweise ausbuchstabiert. Diese Menschen wollten leben, dafür nahmen sie Risiken in Kauf, die in keinem Verhältnis zu dem standen, was sie erwartete. Er lebte doch auch – was also fehlte ihnen? Anders gefragt, auch wenn es auf dasselbe hinauslief: Was hatten sie ihm voraus? Hatte es einen Zweck, sie zu beneiden? Wenn ja: weshalb? Sollte er sie bedauern? Wozu? Hatte er sie in die Falle gelockt? Warum hätte er so etwas tun sollen? Hatten nicht, genau besehen, sie ihm eine Falle gestellt – ihm, von dessen Existenz, geschweige denn seiner Gegenwart mitten unter ihnen, sie nicht das Geringste ahnten?
Was wäre aus ihm geworden, hätte das Politbüro nicht einen Ausgestoßenen benötigt, der es übernahm, diese Schweinereien zu organisieren? Andererseits: Hatte das Politbüro entfernt eine Vorstellung davon besessen, wie überaus erfolgreich er die ihm zugewiesene Aufgabe bewältigen würde? Das anzunehmen war nicht wahrscheinlich, es zu bestreiten hingegen konnte zu Scherereien führen, gegen die gehalten diese Bootsfahrt vermutlich einem Kinderspiel glich.
Zum zweiten Mal seit seiner Ernennung überkam Fac ten Chek der Wunsch nach Meditation. Das Flappen eines Rotors brachte die Luft zum Vibrieren. Aus fünfhundert Kehlen löste sich ein Schrei. Gleichgültig, wer da schrie: niemand würde sich seiner erinnern. Die New Yorker Geschäftspartner, stets misstrauisch gegenüber der Machtlogik post-sozialistischer Regime, hatten den unersetzlichen Freund in der schwimmenden Nussschale geortet und angesichts eines aufziehenden Sturms entschieden, mit seiner Bergung nicht länger zu warten.
8
In Hanoi gelandet, ließ sich Fac ten Chek beim Minister melden. Den Termin erhielt er, wie nicht anders erwartet, umgehend. Aus langer Erfahrung wusste er, dass die Protokolle seiner New Yorker Gespräche bereits fertig getippt und gelesen auf dem Schreibtisch des hohen Genossen lagen. Das Angebot der Partner hatte Fac ten Chek nicht wirklich überrascht. Auf jeden Fall war es ihm gelungen, die Überraschung vor allen Parteien, sich selbst eingeschlossen, lückenlos zu verbergen – folglich gab es sie nicht. Er war beeindruckt: Ganz gut fasste dieser altväterliche Ausdruck seine augenblickliche Seelenlage zusammen.
Als eine Runde Reisschnaps in den Konferenzraum getragen wurde, wusste er: etwas Großes stand an. Es lag nicht am Getränk, sondern an der Art, wie man es servierte und wie sich ihre Augen verengten, als er das Glas hob. Er hatte mit Russen gesoffen und kein Gegenüber konnte sich der gegründeten Erwartung hingeben, dadurch seine Aufmerksamkeit zu schwächen oder sein Pflichtgefühl auszuhebeln. Dennoch stand, in ebenso unübersehbaren wie unsichtbaren Versalien, quer durch den Raum das Wort ILLUSION.
Wessen Illusion? Zu dieser Runde besaß nur Zutritt, wer zum Club der Illusionslosen gehörte: Das galt als ausgemacht und gehörte sich so. Fac ten Chek wäre nach allem, was er erlebt hatte, sehr erstaunt und ein wenig ungehalten gewesen, hätte einer der Anwesenden aus Überzeugung oder Versehen das Lob der Freiheit angestimmt oder die amerikanische Verfassungspräambel zitiert – Bibelworte gingen schon eher, da gab es manchen gepfefferten Spruch, auf den man anstoßen konnte, auch ließ sich gelegentlich ein Mao-Wort einmischen, ohne dass es den Gesprächspartnern auffiel.
Wessen Illusion? Auf ihren Karten, vor seinen zusammengekniffenen Augen von diskreten Mitarbeitern auf übergroße Bildschirme projiziert, schrumpfte Saigon, sein Saigon, zu einem Neben-Business, einem winzigen Aktivitätsknäuel im Grenzbereich statistischer Irrelevanz, fast vergleichbar dem heimischen Sonnensystem am Rande der ausufernden Galaxis. Dort kannte er sich aus, dort war er zu Hause. Von dort zogen sich Linien zu den klassischen Schleusenpunkten der reichen Welt, an denen die Verteilung auf die gewohnten Zielgebiete erfolgte. Er brauchte nur die Augen zu schließen, um Namen, Zahlen, Umschlagplätze, technische Schwierigkeiten mitsamt ihren Lösungen, Bestechungsketten, überzeugte Mitwisser und -täter in Politik und Medien, Ermittler, Gegner, Feinde und Gönner des Unternehmens Revue passieren zu lassen, dessen Fäden in seiner Hand zusammenliefen.
»Ich lerne«, grunzte er und strich sich über die Handfläche. Das Ganze kam ihm vor, als hätten sich die fiebernden Hirne tausender spielesüchtiger Freaks zusammengeschlossen, um, vorerst virtuell, den Planeten zu einem gigantischen Weltraumbahnhof umzurüsten: Wer gab sich mit so etwas ab?
»Ein alter Bekannter.«
Sein Finger legte sich auf einen der hot spots, an denen imaginäre Besucherströme, bestehend aus Millionen von Individuen, aufeinandertrafen, um entlang markierter Routen auszuschwärmen und eine Reihe von Zielregionen anzusteuern, deren Mehrzahl in den Augen des erfahrenen Organisators gegenwärtig nahezu uneinnehmbaren Festungen glich.
Eine Weile sagte er nichts. Sein zusammengekniffenes Auge durchflog, gleichsam im Zeitraffer, einen akribisch geplanten Menschheits-Aufbruch, dem offenbar, das war das Verzweifelte daran, sein galaktisches Ziel abhanden gekommen war. Die enttäuschten und verstörten Massen würden jeden Einzelnen, jede Gruppierung überrennen, die es wagen sollten, sich ihnen in den Weg zu stellen. Stärkeren Widerständen würden sie ausweichen. Sie würden sich teilen, sie einschließen, ihrer Wirkung entkleiden und die Trümmer gleichgültig hinter sich lassen. War es grausame Kriegstaktik, verbrannte Erde zu hinterlassen, so bestand die luzide Taktik dieses Projekts darin, Infrastrukturen zu verbrennen – weltweit.
Ein Projekt, keine Illusion: durchgeplant für eine Reihe von Jahren, mit präzisen Ziel- und Zeitangaben versehen, ausgestattet mit Kooperationsvorgaben, Budgets, Renditeplänen, mit Listen von Geldgebern und -empfängern, von Finanziers und Söldnern, dahinter Namenkolonnen ohne Ende. Eine Reihe von Chiffren, soviel stand fest, erschloss sich ihm erst, wenn seine Unterschrift unter einer Handvoll bereitliegender Dokumente trocknete.
»Wie heißt das Projekt?«
Ein Plakatständer wurde hereingerollt. In gestochenen, die Aura von Hochglanz-Prospekten verströmenden Lettern las Fac ten Chek: ›ILLUSION‹.
Sie lieben den Kitsch, dachte er fast traurig, was kann man da machen?
Am besten, man hält sich an ihre Regeln.
9
»Wie soll das funktionieren? Wo bleibt die Politik?«
»Okay, Sie sprechen die Frage der Feinsteuerung an. Öffnen, schließen, kontingentieren, Begehren wecken, Wege freischalten, umlenken, bürokratische Verfahren implantieren, je nach Bedarf und Stimmungslage der Bevölkerung verlangsamen, beschleunigen, für eine gewisse Zeit aussetzen – die Politik wäre, unserer bescheidenen Auffassung nach, gut beraten, sich diese Techniken in einem sehr begrenzten, sehr übersichtlichen Zeitraum zu eigen zu machen, will sie nicht völlig die Kontrolle über die Grenzen und damit ihre wesentliche Machtbasis verlieren.«
»Warum sollte sie?«
»Sie wollen wissen, was uns die Macht gibt? Kommen Sie, die Macht existiert, sie ist bereits unterwegs, wir versuchen lediglich, ihr ein Bett zu verschaffen.«
Die Praxis der Geschäftspartner, ohne Vorwarnung in die Terminologie von blockbusters hinüberzuwechseln, hatte Fac ten Chek in den Anfängen seiner Tätigkeit verwirrt. Dann war er dahintergestiegen, dass der switch nur in seinem Gehirn passierte, während sie einfach daherredeten, wie die Sprache es ihnen eingab. Barfuß lief er über die Straßen der Kleinstadt, in der sein Vater vor kurzem den Reislöffel abgegeben hatte. Mit ihm zogen die Jahre des großen Krieges, die Napalmwalze, das Millionengebirge aus Toten und Krüppeln, die erbittert dem Feind aus dem Osten Widerstand geleistet hatten, um ihr Land vor seinem Zugriff zu retten. An den Rändern der unerbittlich fließenden Erinnerung lösten sich die boat people, die das endlich befreite Land nicht länger als das ihre betrachteten und draußen, wenn sie denn ankamen, sich in die Heimat zurücksehnten, er wehrte sich heftig gegen das Ertrinken und merkte, wie ein Schleier über seine Augen fiel.
»Kein Mensch verlässt seine Heimat ohne Not.«
»Das lassen Sie unsere Sorge sein. Nein, das wäre nicht richtig ausgedrückt, wir haben damit nichts zu tun. Glauben Sie uns: Die Not wird kommen, sie rollt schon. Die Aufgabe – nicht unsere Aufgabe, aber die Aufgabe derer, die wir beraten – wird einfach sein, sie zu steuern. Unsere Analysen … Sie wissen, wir haben ein paar clevere Entwickler im Keller. Sie haben eine neue Methode ausgetüftelt, ganz recht, nicht hier in New York, das wäre zu … nah ... Frankreich ist besser, Fontainebleau, sagt Ihnen das was? Sie sind ein Bonvivant. Vive la France! Tchin tchin! Die Prognosen sind wirklich zuverlässig … großartige Methode ... decken sich mit dem, was die meisten Politiker ohnehin erwarten ... eine Ära der verdeckten Kriege, Horror aus der Steckdose, gezielte Luftschläge, die das zivile Leben ganzer Regionen erliegen lassen, Angriffe auf Schulen, Krankenhäuser, Reha-Zentren, Pflegeheime, Fernsehstationen, hier und da ein Elektrizitätswerk, Behörden … überhaupt Behörden, Terror natürlich, allgegenwärtig, fester Bestandteil des Alltags von, sagen wir, jedermann, nichts wirklich Neues also, nur, sagen wir, Schritt für Schritt sich verschärfend … ausufernde Mikrogewalt, falls Ihnen der Ausdruck lieber ist ... wird die Bindung der Menschen an die ihnen so teuren Landschaften lockern, Nachbarschaften auslöschen oder vergiften, Qualifikationen pulverisieren, die Schulsysteme zerstören, den glühendsten Patriotismus in eine Kloake verwandeln. Die Menschen werden lernen, die Schlepper zu lieben.«
»Warum macht ihr das?«
»Diese Frage sollten Sie nicht stellen.«
»Welche Frage sollte ich denn stellen?«
»Diese Frage sollten Sie stellen.«
»Was erwarten Sie?«
»Dass Ihr Staat Sie freigibt. Die Zeit der Geheimbehörden ist vorbei. Gründen Sie eine Nichtregierungsorganisation und wir sind im Geschäft.«
10
Der Minister lag irgendwie tot hinter dem Schreibtisch. Er hatte den großen Krieg an allen bürokratischen Fronten geführt und überstanden. Er war der Joker. Falls auf der polierten Tischoberfläche eine Akte gelegen hatte, so war sie verschwunden.
Der Anruf kam, wie erwartet, als Dreingabe. Nur die Filmmusik fehlte. Ein Hauch von dead soap lag über der Szene. Fac ten Chek, der jede Stimme, einmal vernommen, mühelos identifizieren konnte, musste sich diesmal geschlagen geben. Auch das hatte er erwartet.
»Ja?« wisperte er.
»Wir sind im Geschäft.«
11
Während der letzten Jahren des Dezenniums hielten sich in Fac ten Cheks Hinterkopf Zweifel am neuen Geschäftsmodell, obwohl es Erträge wie nie in die Kassen spülte – es gab die Kriege, es gab den Terror, es gab Massenflucht und -vertreibung, es gab Konflikte mit den aufnehmenden Bevölkerungen, doch all das hielt sich in gewissen regionalen Grenzen, es fehlte der Impuls, der die prognostizierten weltweiten Ströme in Gang setzte. Dann, nach dem Anschlag auf das Word Trade Center, schlug der Wind um. Schlagartig lichteten sich die Nebel. Ein paar Wochen gingen ins Land und unter den Mitspielern rund um den Globus herrschte Aufbruchstimmung. Zum harten Kern der Geschäftsleute schlossen ein paar blitzgescheite Intellektuelle auf, denen man, wie das hieß, kein X für ein U vormachen konnte. Nur die Gewinnmargen – sicher ist sicher – hielt man vor ihnen geheim. Das war goldrichtig, solange sie willig für die gute Sache kämpften – später, als es darum ging, sie im Zaum zu halten, erwies es sich als zwingend.
Fac ten Chek, breit geworden im Lauf der Jahre, hat sich ein Schild We the People Refugees umgebunden und sammelt Unterschriften auf der Fifth Avenue – inkognito, wie sich versteht, noch immer kann er von seiner alten Gewohnheit nicht lassen. Das Schild findet er läppisch. Etwas daran stört seine Intelligenz und die immer noch vorhandenen Reste seines vaterländischen Elans. Aber die Organisation hat gute Werte damit erzielt und den Gebrauch zwingend vorgeschrieben. We sell solutions. Fac ten Chek könnte sich im Büro rekeln und den Tag vertelefonieren, aber das hier fühlt sich gut an und erinnert ihn an die Anfänge. Er mag die Fifth Avenue, die eleganten Geschäfte, manchmal weht ein Duft heraus, der ihm Reisfelder vor untergehender Sonne vors Auge zaubert oder die Nase mit dem Explosionsgeruch einer Granate erfüllt, der Übergang ist fließend wie die Bewegungen der eiligen Kundinnen mit den Riesen-Sonnenbrillen und wie die Erinnerung selbst. Knapp ein Jahr ist vergangen, seit die Frau an seiner Seite einer schleichenden, die Ärzte ratlos lassenden Krankheit erlag. Ein Gefühl, diffus und nagend, lässt ihn auf einen der ihm unablässig nachstellenden Geheimdienste tippen, es ist zwecklos, sich etwas vorzumachen oder Nachforschungen in die Wege zu leiten.
Die Organisation duldet keine Eskapaden.
12
Aus der Zweiundvierzigsten drängt eine Demonstration ins Blickfeld, Fac ten Chek muss das Auge beschatten, um die Plakate zu erkennen. Nein, er kennt sie nicht. Sollte er sie kennen? Pappschilder, handgemalt, schwer zu entziffern. Wenig effizient. Mit Liebe gemalt … oder mit Hass, mit irgendetwas, das wie Herzblut aussieht und schnell eintrocknet. Auch Nichtwissen ist eine Form des Wissens, und nicht die leiseste … eine Weise, sich die Erde untertan zu machen. ›Das sagt mit jetzt nichts‹ – wer hat das gesagt? Wer alles zusammenzählte, was Menschen ›nichts sagt‹, der hielte den Schlüssel zur Welt in seinen Händen ... er müsste nur noch ans Schloss … Fac ten Chek … Was ist das für ein Geschrei? Ach-du-Schreck? Be-sen-weg? Entfernt Vertrautes, dicht unter der Oberfläche des Bewusstseins zusammengezogen, mischt sich hinein, mischt mit, so kommt es ihm vor, es kommt ihm vor, das kommt vor, das soll vorkommen, eine Art Verschiebung ist da im Gang.
Aus dem Gebrüll dringen Silben:
Fact-’n-check, F’ac-ten-check, Fac-Ten-Chek, Fak-ten...
Jede Variante ergibt einen Sinn. Gut oder nicht: Sinn bleibt Sinn. Welcher Sinn gilt? Welcher gilt hier und jetzt? Welcher hat die älteren Rechte? Wer macht sie geltend?
Ho-Chi-Minh –
Blinzelnd sieht er sich um. Niemand beachtet ihn, kaum jemand unterzieht sich der Mühe, dem Demonstrationszug mit der Aufmerksamkeit zu begegnen, die sich seine Organisatoren vermutlich versprochen haben, nur in Fac ten Cheks Ohren zischt es: Enttarnt!
Wurde er enttarnt? Wenn ja, von wem? Mit welchen Mitteln? Wer denunziert ihn? Warum jetzt? Wissen die Demonstranten, auf wen sie losgelassen wurden? Wenn es ein Geheimnis der Straße gibt, dann dieses: dass sie missbraucht wird. Kalte Verachtung steigt in ihm auf, die lange gelegen hatte, jubelnde, Parolen brüllende, in Vierer- und Sechserketten marschierende Jugend, unwissend und hochmütig, selig in sich selbst und bereit, den Nächstbesten zusammenzutreten, sobald jemand auf ihn zeigt.
Wer zeigt auf ihn? Wer hat ihn zur Zielscheibe erkoren? Wer erlaubt sich dieses barbarische Späßchen? Wo bleibt die Organisation? Wer bewahrt ihn vor denen da? Wer beschützt ihn im Angesicht des Prangers, der Pfiffe, der Schläge, der Steinwürfe, der Selbstbezichtigungen, der Fesseln, des Abtransports?
Wie es scheint: niemand. Es ist also soweit. Alles, was er jemals im Lager gelernt hat, drängt in seinen Körper und treibt ihn vorwärts. Schlaff, unauffällig, die Augen auf den Asphalt geheftet, Fuß vor Fuß. Nach rechts hin öffnet sich die Straße, ein paar Schritte, fast ohne Atem, und er hat es geschafft.
13
»Fac ten Chek!«
Die scharfe Stimme, wo hat er sie schon gehört?
Ein Desaster.
»Es war nicht leicht, Sie aufzuspüren, aber auf der Zielgeraden ging alles ganz einfach. Ihre Frau hat uns übrigens auf Ihre Spur gebracht. Eine wunderbare Person, finden Sie nicht? Sie hat sich anschließend vergiftet, ich nehme doch an, Sie wissen es schon.
Faktencheck? Geht’s noch? Jeder, der in unserer Branche arbeitet, weiß, dass man nicht schnell ein paar Jungs oder Mädels hinter die Bühne schickt, um festzustellen, was Fakt ist. Welch blühender Unsinn! Wie kommt es, dass so etwas die Fernsehanstalten im Sturm erobert? Kein Interview ohne Faktencheck! Kein Gesprächszirkel ohne Faktencheck! Das sollte uns nicht misstrauisch machen?«
»Es hat Sie misstrauisch gemacht.«
»Das kann man sagen.«
»Aber warum ich?«
»Also hören Sie! Sie sind es doch. Nach wem hätten wir Ihrer Ansicht nach suchen sollen?«
»Nach wem haben Sie denn gesucht?«
»Gute Frage, nächste Frage. Sie glauben doch nicht im Ernst, wir hätten herausbringen wollen, wer hinter diesem läppischen Sendeformat steckt. Uns reizte die Übereinstimmung – die corréspondance – der vage Gedanke, irgendwo könnte etwas vorgehen, das dem offenkundigen Nonsens Sinn verlieh. Irgendwo etwas… Sie begreifen den Reiz? Unsere Jungs zerlegten das Stichwort, das Klingelzeichen, wenn Sie so wollen, in seine Einzelheiten und unterwarfen es allen möglichen Computerroutinen. Lachen Sie nicht, ich weiß, das klingt schrecklich oberflächlich, aber so arbeiten die Dienste heute. Jedenfalls zum Teil.«
»Was kam dabei heraus?«
»Nichts. Nichts, was Sie interessieren könnte. Nonsens, wenn Sie gestatten, dass ich mich wiederhole.«
»Aber Sie haben mich gefunden.«
»Das ist eine andere Geschichte. Kommen Sie, ich lade Sie ein. Die Straße ist nichts für einen wie Sie und mich.«
14
Er hätte es doch wissen müssen.
Hände auf dem Rücken, gefesselt, Klebstreifen über dem Mund wie im billigsten Kinofilm, in ein Loch verfrachtet, gegen das gehalten die väterliche Hütte einer gehobenen Hotelsuite glich, analysierte Fac ten Chek seine Lage. Keiner der ihm bekannten Dienste wäre so vorgegangen. Der Gedanke, in die Hände von Stümpern gefallen zu sein, beschäftigte ihn stärker als das ungewisse Schicksal, das ihm bevorstand. Was war passiert? Wo blieb die Organisation? Warum hatte sie ihn nicht abgeschirmt?Was tat sie jetzt? Arbeitete sie an seinem Fall? Wusste sie, wo er sich befand? Wo befand er sich eigentlich? Betrachte die Lage von außen: Regel Nummer eins. Nummer zwei und drei, die er sich für den Ernstfall zurechtgelegt hatte, mussten erst einmal warten.
»Sie liegen falsch. Ganz falsch.« Unerwartet riss ihm der – beinahe – Unsichtbare, der sich in seinem Rücken zu schaffen machte, das Pflaster vom Mund. Eine schwache Spiegelung im Mobiliar klärte Fac ten Chek auf: Er hatte es mit einem ziemlich harten Burschen zu tun.
»Hätten Sie die Güte, mir auseinanderzusetzen, was ich falsch sehe, damit ich meine Sicht auf das Geschehene berichtigen kann?« fragte Fac ten Chek höflich.
»Das Geschehene ist geschehen.«
»Zweifellos. Das Wirkliche ist wirklich und das Mögliche ist möglich. Hören Sie, ich habe nicht unbegrenzt Zeit und Sie verschwenden die Ihre mit Kinkerlitzchen.«
»Sie haben mich nicht verstanden. Das Geschehene ist geschehen. Niemand kann es ausradieren und durch etwas anderes ersetzen. Verstehen Sie jetzt?«
»Wer sollte so etwas unternehmen?«
»Das fragen wir uns auch.«
»Sie stellen Fragen?«
»Unter anderem, unter anderem. Eigentlich möchten wir, dass Sie sich Fragen stellen. Sie und Ihre Organisation.«
»Was wissen Sie über meine Organisation?«
»Nichts, was Sie interessierte. Nichts, was uns interessierte. Uns interessieren Sie.«
Fac ten Chek schüttelte mühsam den Kopf.
»Wenn Sie das Gewesene interessiert – studieren Sie Geschichte. Wenn Sie wissen wollen, was gerade geschieht – lesen Sie die Nachrichten. Wenn Sie wissen wollen, was ich denke – ich weiß nicht, ob Sie das etwas angeht, aber bitte –, dann fragen Sie. Fragen Sie ruhig. Ich befinde mich in Ihrer Gewalt. Nur für den Fall...«
»Warum?«
»Weil Sie sonst nichts von mir erfahren.«
»Wer sagt Ihnen, dass wir etwas von Ihnen erfahren wollen?«
In Fac ten Cheks Kopf glomm ein Lichtlein auf und erlosch.
»Sie wollen etwas über mich erfahren?«
»Ach, kommen Sie. Wir wollen wissen, wer Sie sind.« Offenbar hatte der beinahe Unsichtbare eine bequeme Sitzposition eingenommen und wippte ein wenig vor und zurück. Fac ten Chek grunzte.
»Wenn Sie zu einer religiösen Sekte gehören: Nur zu! Sie dürfen auch foltern.«
»Soso. Jaja. Sie sind ein Gehärteter. Das ist bekannt.«
»Was dann?«
»Was meinen Sie?«
»Lassen Sie mich gehen.«
»Angenommen, wir lassen Sie gehen…?«
»Sie können mich anrufen.«
»Dem steht nichts im Weg?«
»Nichts.«
»Also gut. Bringen wir’s hinter uns. Sie liefern Menschen allen Gefahren aus, die sich auf diesem Erdball auftreiben lassen, das alles, um, wie Sie sich ausdrücken, ihnen dabei behilflich zu sein, ihr Glück zu finden. Hätten Sie die Güte, uns eine einzige Frage zu beantworten? Die Frage … ja natürlich. Wären Sie bereit, eine einzige dieser Gefahren mit einem Ihrer Kunden teilen zu wollen? Genau das haben wir uns gefragt, als Ihre Frau uns auf Ihre Spur brachte. Übrigens war sie nicht illoyal, sie war nur … sagen wir … verwirrt.«
»Um mich das zu fragen, schleppen Sie mich hierher?«
»Wir fragen Sie nicht. Sie fragen und wir erfahren, was immer wir wollen.«
15
Die Realität, ein löchriges Sieb, dient dem Zweck, etwas zurückzuhalten.
Wer sich lange in Zurückhaltung übt, vergisst irgendwann, dass auch seine Motivation ursprünglich von außen kam. Er pflegt die Utopie der Enthemmung, er lehnt sie ab, er verabscheut sie, fürchtet sie – aber er träumt sie, Tag und Nacht, Nacht für Nacht, Tag um Tag, sie ist seine Monstranz, er ihr Priester, er schreibt ihr Wirkungen zu, die den erdnahen Raum der überlieferten Wunder wie Spontanheilungen, Jungfernzeugungen, Auf-dem-Wasser-Gehen, Brot-und-Wein-Vermehrung verlassen und sich zu einer Erfahrung jenseits aller Erfahrung verdichten, der einzigen, für die es sich im Grunde lohnt, zu leben und zu sterben, jedenfalls für Wesen, die irgendeinen Lohn in ihrem Dasein finden und sich nicht mit dem bloßen Vegetieren begnügen wollen. Ließe so ein Wesen die antrainierte Zurückhaltung fahren, es fände sich rascher, als ihm lieb wäre, und unvermuteter, als es sich vorstellen könnte, in jenem Sieb wieder – aufgefangen, wenn man so will, von einer Art Sicherungsnetz, aber auch gefangen, abgehalten von der Verfolgung seiner Ziele und Wünsche, ohne genau zu begreifen, wo der Widerstand liegt und wie ihm zu begegnen sei. Anstelle von Zielen erkennt er plötzlich Bilder ... Bilder von Menschen und Zuständen, die ihm einst nahegingen oder durch die er sich eingeengt fühlt, Bilder in allen Schattierungen der Undeutlichkeit, die ihm ohne Unterlass zuflüstern: Kümmere dich um uns, denn wir sind wirklich, wir waren wirklich und werden es sein, solange du nicht ins Gras beißt – womit du uns, wie du vielleicht weißt, hintergehst, denn wir sind so wirklich wie du. Was wird mit uns geschehen, wenn du zu existieren aufgehört haben wirst? Wir gehören dir nicht, wir folgen dir nicht ins Nirwana oder wohin du dich zu begeben wünschst, wir sind hier, wir gehören hierher, denn wir sind: die Realität. Hast du darüber nachgedacht, wie es sich anfühlt, wenn eine Realität brennt?
Fac ten Chek lag auf dem Bett und entspannte. Er hatte den Körper zur Seite gedreht, die Beine leicht angewinkelt, die Arme nach vorn gestreckt, atmete flach und sank von einem Spannungstableau aufs nächste. Die Tiefenatmung sprang an und setzte eine Flut unerwarteter Bildsequenzen in Gang, bekannter und unbekannter, grotesker und sanfter, dunkler und heller, scharf gezeichneter und sanft verfließender … es war nicht nötig, sie zu mustern, so wie sie waren, bildeten sie einen Teil seiner Aufmerksamkeit auf die Welt, ein Innenaußen, bereit, im Fall der Fälle ihn zu verraten, an allen und jeden, der sich ihrer zu bedienen wusste … Täter und Opfer, Mittäter und Mitopfer, Nebentäter, Haupttäter, Täter hier, Opfer dort, Opfer hier, Täter dort, Opfer- und Tätergruppen, Ertrunkene, dem Ertrinken Nahe, reglos Treibende, Zuckende, Schreiende, Männer mit Sturmgewehren, Männer mit Rettungswesten, Bergen von Rettungswesten, gestapelt in dunklen Schuppen, aus fliegenden Helikoptern geworfen, leckgebohrte Schlauchboote, die sich in Zeitlupe zusammenfalteten und die australischen, europäischen, nordamerikanischen Träume afghanischer, angolanischer, somalischer, eritreischer, sudanesischer, nigerianinischer, kongolesischer, kolumbianischer, iranischer, syrischer, indonesischer, irakischer, pakistanischer, libanesischer, polynesischer Bauernsöhne und -töchter, Handwerker, Händler, Spieler, Drogensüchtiger, Dealer, Betrüger, Hochstapler, Arbeiter inexistenter Fabriken, Bettler, Kleinganoven, Klimaflüchtlinge, Glücksritter, Glaubenskrieger, Viehtreiber, führerscheinloser Taxifahrer, religiös fühlender und sorgsam verhüllter Gattinnen, Mütter, Ärztinnen, Schwangerer, Krankenschwestern, Näherinnen, Haupt- und Nebenfrauen, Bräute, Klofrauen, Nutten, Sekretärinnen, Studentinnen, Übersetzerinnen in die Tiefe zogen, hinter ihnen Granateneinschlag und Dürretod, beschauliche Kleinstadtruhe und der Schmutz endloser Slums, Polizeieinsätze und Hundestaffeln, Todesschwadronen, Drogenbarone, Befriedungsprogramme, Wohnungsbauprogramme, Einberufungen, Überfälle, Vergewaltigungen, Kinderehen, Kinderprostitution, die ganze Skala menschlicher Tätigkeiten, Bedürfnisse, Verirrungen, Abgründe und Banalitäten.
16
Fac ten Chek war bekannt, dass im Westen eine Lehre kursierte, der zufolge jeder Lebende am Elend seiner Mitlebenden, aber auch der Toten Schuld trug, eine Schuld, die sich nicht auf Verwandte und Genossen begrenzen ließ, nicht auf die Stadt und nicht auf das Land, in dem man geboren war oder in dem man lebte, nicht auf den Kontinent, der einen trug oder auf die Vorgängergeneration, von deren Leistungen man zehrte und deren Schandtaten man auszulöffeln hatte, nicht auf die Generation davor und nicht auf die Jahrhunderte davor, soweit sie der eigenen Geschichte zugerechnet wurden, nicht auf die Zivilisation, der man angehörte, und nicht auf die Menschheit, als deren Teil man sich verstand, eine schlechterdings unbegrenzte, bis an die Grenzen des Universums vorstürmende, vor keiner Lebensform Halt findende Schuld –: ihm war bewusst, dass es sich dabei keineswegs um eine Geheimlehre handelte, eine Verschwörungstheorie oder dergleichen, sondern um das unverrückbare Fundament ihrer Lebensform, das ›eigenste Eigene‹, die Schwäche, die zur Stärke geworden war und sich die Erde untertan gemacht hatte, die jetzt unter der eigenen Stärke litt und die längst dahingeschmolzene oder langsam schwindende Herrschaft über den Rest der Welt – beide Deutungen existierten berührungsfrei neben- und durcheinander – in die Auszeichnung dieser Schuld investierte, in einen Kultus, bei dem, wie zur Zeit der Hexenprozesse, der geringsten Handlung eines Einzelnen, dem Kosmetikkauf eines Schulmädchens, dem Autobahnspurt eines Sportwagennarren, dem Tagebucheintrag eines Bloggers magische Fernwirkungen zugeschrieben wurden mit der Macht, den Gang der Menschheit zu verändern und über das Schicksal der Erde zu entscheiden.
In den wenigen Jahrzehnten, in denen es das Fernsehen gab, war diese Schuld des Westens, deren intime Kenntnis sich bis dahin grosso modo auf die Alte und Neue Welt beschränkt hatte, zum globalen Hit geworden, er hatte die ›restliche Welt‹ restlos überzeugt und erregte zusehends ihre Bewohner, ohne dass es dazu noch der kommunistischen Agitation bedurfte, in der auch seine Wenigkeit ausgebildet worden war. Durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine übergroße Schuld, murmelten die Kirchgänger der christlichen Gemeinden, sie murmelten es seit Jahrhunderten, er hatte sich selbst davon überzeugt und es hatte ihn fassungslos gemacht, bis ihm auffiel, dass der Satz, der lange Zeit unverrückbar über seiner eigenen Stirn geleuchtet hatte: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern, dieser Ur-Satz aller dialektischen Materialisten, nichts weiter darstellte als eine Interpretation jener völlig entleerten und so überaus wirksamen Kirchenformel unter anderen. Zweifellos musste ein Trick dabei sein, den die Hüter der östlichen Weisheit übersehen oder aus unerfindlichen Gründen zu nutzen verabsäumt hatten.
Es fiel auf, dass jene, die sich zu ihrer umfassenden Schuld bekannten, wie selbstverständlich auf der Seite all derer standen, an denen sie schuldig geworden zu sein behaupteten: Sie gaben die Schriften ihrer toten Feinde heraus und akzeptierten ihre Beweggründe posthum, sie gruben mit gleicher Inbrunst die Knochen der Dinosaurier und Neandertaler wie die Gräber fremder und eigener Ahnen aus – letztere durften seit einiger Zeit nicht mehr so genannt werden, weil man damit die Anderen hätte kränken können –, um zu analysieren, zu restaurieren, zu rekonstruieren und die Ergebnisse der Allgemeinheit in Museen zugänglich zu machen, welche nichts weiter darstellten als Orte eines wahllosen, erdumspannenden Reliquienkultes, der nur darauf wartete, ins All vorzustoßen. Sie verteilten mit derselben freudigen Erregung Waffen an Rebellen und Regierungen, mit der sie Impfstoffe an Krankenstationen verteilten, Giftfabriken in alle Welt lieferten und Gelder für den Wiederaufbau von ihnen zerbombter Innenstädte bereitstellten. Sie zeigten sich, an welchem Ort der Welt auch immer, busy, sobald sich dort eine Initiative bildete, um eine Schuld – und damit die Schuld aller – einzufordern. Wo immer sich ein Bewusstsein bildete, wo immer sich eine Feindschaft aufbauen konnte, wo immer etwas gegen ihren Willen und ihre Vorstellung zu geschehen drohte, waren sie zur Stelle und übernahmen die Initiative.
Die Öffentlichkeit war der Ort, an dem dies täglich verhandelt wurde. Das Land, in dem eine Öffentlichkeit existierte, war zuverlässig ein Teil des Westens. Die ersten Schritte auf dem Weg in die Diktatur bestanden darin, sie zu beschneiden, Verbindungen zu kappen, die Anzahl der Fernsehkanäle zu beschränken, lästige Moderatoren auszuwechseln, Facebook-Einträge und -Accounts zu liquidieren, die Verfasser an den Pranger irgendeiner angesagten, hippen oder ergebenen Meinung, Autoren unter Verdacht, Reporter und Kommentatoren unter Arrest zu stellen, ihre Pässe einzuziehen, ihre Autos und Büros abzufackeln, ihre Leser, Abonnenten, Verteidiger zu bedrohen und Verfolgtenstatus für die Parteigänger der Regierung sowie ihre Schlägertrupps zu reklamieren.
Fac ten Chek kannte den Katalog der zu ergreifenden Maßnahmen gut. Oft genug war er dabeigesessen, wenn die Organisation Staaten beriet, in denen der Bürgerkrieg vorbereitet wurde und neue Flüchtlingsströme geplant werden mussten. Gnadenlos wurden Staaten, eben noch Teil oder nahe Verbündete des Westens, mit Entwicklungsgeldern und gemeinsamen Projekten verwöhnt, auf bestem Wege, in die Haute Société der voll entwickelten Industriegesellschaften aufzusteigen, binnen Tagen auf Paria-Status gedrückt, ihre Kreditwürdigkeit sank ins Bodenlose, eine Reihe von Aktienkursen kletterte auf Rekordhöhe, andere fielen tief. Währenddessen saß die Weltöffentlichkeit zu Gericht, übte sich in brüchiger Solidarität mit einer Handvoll malträtierter oder auch nur geschickter Journalisten und diskutierte die entstandene Gefahr für den Weltfrieden. Der Weltfrieden, soviel ergab eine flüchtige Recherche, geriet immer dann in Gefahr, wenn der Westen einmal mehr versagt hatte, sei es, dass er die Falschen geschmiert, sei es, dass er nicht so gehandelt hatte, wie es seiner innersten Natur und dem Wesen seiner Schuld entsprochen hätte.
17
Das System, dem Fac ten Chek seine Ausbildung verdankte, hatte es anders gehalten: öffentlich angeschlagen wurde die Schuld der anderen, der Abweichler, Renegaten, Volksfeinde, Verschwörer, Klassenfeinde, Agenten des Kapitals, Handlanger des Imperialismus undsofort, sie wurde nicht etwa diskutiert, kultiviert, relativiert oder gar in Zweifel gezogen, sondern festgestellt, verkündet und exekutiert. Über sie hinaus gab es keine Schuld, jedenfalls keine, die einer nach eigenem Gusto sich aufladen konnte, um anschließend damit hausieren zu gehen. Genau betrachtet gab es überhaupt keine Schuld. Das private Dasein, Hauptquell und Hauptursache jeder persönlichen Schuld, hatte aufgehört zu existieren und eine überpersönliche Schuld war nicht vorgesehen, solange einer in Reih und Glied ging und ebenso dachte. Auch der Abweichler trug, so gesehen, keine Schuld, er war zwar schuldig, doch die Schuld bestand in der Abweichung und konnte nicht beglichen, sondern nur geahndet werden, am besten und schmerzlosesten durch Liquidation, das heißt Auflösung aller Verbindlichkeiten per Genickschuss oder Axthieb.
In den Lagern wurde keine Schuld abgearbeitet – gerade in diesen Regionen der äußersten Bitterkeit, in denen die niederen Instinkte des Menschen obenauf kamen, war sie vollständig unbekannt. In ihnen erbrachten Volksfeinde, deren Gesinnungen gleich gefährlichen Viren von der Bevölkerung ferngehalten werden mussten, ihren zugemessenen Anteil am kollektiven Arbeitsaufkommen – unter deutlich erschwerten Bedingungen, doch dafür gab es Gründe, die teils in der Prävention, teils in den organisatorischen und menschlichen Unkosten lagen, die sie verursachten, teils darin, dass in Wahrheit sie jene Toten auf Urlaub waren, als die sich die Sturmtruppen der Revolution in den kapitalistischen Ländern einst gefühlt haben mochten.
Flüchtlinge, sofern sie die unvorstellbare Torheit begingen, ihren Fuß in eines jener Länder zu setzen, gehörten unbedingt zur natürlichen Flora und Fauna der Lager. Sie zu isolieren war Pflicht eines jeden Genossen, immerhin schleppten sie das Virus der bürgerlichen Weltanschauung ein, dazu eine kaum überschaubare Vielzahl älterer feudalistischer, religiöser, atavistischer, konfuzianischer Denk- und Verhaltensmuster, die zu erkennen und korrekt einzuordnen selbst geschulten Parteioffizieren gelegentlich schwerfiel. Als Andere teilten sie den Status der ausgesonderten Volksfeinde, ihre Schuld bestand darin, nicht Gleiche und damit der allgemeinen Schuldlosigkeit teilhaftig zu sein.
Im Westen lag die einzig legitime Weise, der Schuld die Stirn zu bieten, in der Möglichkeit, anders zu sein und zu wirken: danach drängelten seine Gelehrten, Schriftsteller, Künstler, Ausstellungsmacher, Designer, Regisseure, Schauspieler, Musiker, Tänzer, Modemacher, Startup-Gründer, Gesundheitsapostel, demonstrativen Weicheier, Politkommentatoren, Neureichen, Einfaltspinsel, Konformisten aller Himmels- und Farbrichtungen, IQ-Protze, Philosophen, Vanbesitzer – die natürliche Horde derer, die im Anderen den kommenden Erlöser witterten und ihm, wo immer möglich, den roten Teppich ausrollten, nicht ohne, hüpfend und feixend um Aufmerksamkeit bettelnd, hinter ihm drein zu ziehen.
Fac ten Chek war lange genug im Geschäft, er hatte seine Witterung für das, was vorging, oft unter Beweis gestellt. Gelöst und nachdenklich stellte er fest, dass sich das Klima änderte. Der banale Hintersinn dieser Phrase leuchtete in seinen Gedankengang hinein wie die nahezu waagrechten Strahlen der untergehenden Sonne –: Fast konnte man annehmen, der westliche und der östliche Schuld-Typus hätten in diesen letzten Jahren fusioniert, um etwas wirklich Neues in die Wege zu leiten, ein neues Gesellschaftsspiel, eine neue Form der Gesellschaft, eine neue Kultur, wenngleich dieser Ausdruck läppisch wirkte angesichts dessen, was da zusammenwuchs an frenetischer Jugend, an Unaufrichtigkeit, Leisetreterei, Kadavergehorsam, Spitzeltum, Meldewut, naivem Stolz auf das Erreichte und noch zu Erreichende, an Bereitschaft, das Offensichtliche auszublenden und den abstrusesten Märchen aufzusitzen, sofern sie in der richtigen Verpackung ausgeliefert wurden und die erwünschte Botschaft transportierten.
Die erwünschte Botschaft – worin bestand sie? Als Koordinator wusste er, dass die Organisation Container anbot, die von den Mechanismen der Fluchtauslösung über die Routenplanung, die Betreuungsangebote für die Besserbezahlenden unter den Fluchtwilligen, die Anwerbung und Ausrüstung der Schlepper mit Material Papieren und Koordinaten bis zur psychologischen Vor- und Nachbetreuung der Zielländer alles umfassten, was zur erfolgreichen Durchführung ihrer Operationen gebraucht wurde. Es galt als ausgemachte Tatsache, durch wissenschaftliche Forschungen erkundet und bestens belegt, dass Massenmigration die Bevölkerung der Zielländer spaltete, und zwar umso giftiger, je entwickelter die Gesellschaft und je ausgeprägter das Angebot an Sozialleistungen ausfiel, das sie bereithielt.
Entsprechend wichtig war es, diejenigen, die wussten, was auf ihre Gesellschaften zurollte, rechtzeitig mundtot zu machen oder durch ein gesundes Prämiensystem auf die richtige Seite zu ziehen. Die üblichen Protestierer, naiv, wie ihresgleichen nun einmal war, ließen sich dann leicht als Unruhestifter brandmarken, als potentielle Staatsfeinde, die, falls man ihnen erlaubte, sanktionsfrei vom Leder zu ziehen, all die Übel heraufbeschwören würden, wovor sie sich fürchteten und wovor sie die anderen warnten.
Das war insofern nicht falsch, als jede Art von Zuständen ihre Akteure benötigte. Von Leuten, die den Unfrieden im Herzen trugen, konnten keine friedensdienlichen Anstrengungen erwartet werden. Also lag es nahe, ihnen Hass auf die Anderen vorwerfen, auf alle Anderen und letztlich auf den Anderen – also die eigentliche Urschuld, deren sich die Gesellschaft unaufhörlich bezichtigte und die nicht anders bekämpft werden konnte als durch Anderssein, gleichgültig, in welchem Format es sich ausdrückte und welche Kosten daraus erwuchsen. Fac ten Chek war zwar nicht unmittelbar mit diesen Aktivitäten betraut, aber er nahm – inkognito – schon deshalb nicht ungern an ihnen teil, weil sie frische Luft und Bewegung versprachen, angereichert mit der angenehmen Aussicht, in erstklassiger Gesellschaft Freundlichkeiten zu streuen und nützliche Kontakte zu pflegen.
Auch sagte ihm sein instinktives Gefahrenbewusstsein, dass hier die Schwachstelle des Systems verborgen lag, die früher oder später auch dieses Geschäftsmodell ruinieren würde.
18
»Ein Land überfallen, wer macht denn so was? Wir bieten maßgeschneidertes Konfliktmanagement an und der Kerl marschiert da ein, als steckten wir wieder in den Dreißigern. Das gibt’s doch nicht. Stoppt den denn keiner?«
Fac ten Chek lächelte seinen Mitarbeiter an.
»Warum echauffierst du dich so?«
»Unser Etat wird nicht reichen. Wir müssen umdisponieren und wissen nicht wie. Die Werte sind chaotisch. Das ist Renditevernichtung.«
»Sprich nicht so.«
Nach der Rückkehr aus der Höhle, wie er das Loch bei sich nannte, hatte Fac ten Chek zwei Dinge in seinem Leben umgestellt: Er lächelte im Dienst und er wachte darüber, dass, jedenfalls in seiner Gegenwart, das Geschäft nur noch in schonenden Worten beschrieben wurde. Die Sekretärin hielt das für einen Code, der sie ausschließen sollte. Entnervt und entrüstet über den Vertrauensentzug verweigerte die Arbeit und erzwang ihre Auswechslung. Die restlichen Mitarbeiter, die nicht wussten, wer, zum Teufel, geschont werden sollte, benahmen sich, als litten sie an Zahnschmerz und seien ausschließlich deshalb zum Dienst erschienen, weil sie ihren guten Willen bekunden wollten. Nur gelegentlich vergriff sich einer in Ton oder Wortwahl.
»Die Militärs ordern Drohnen wie wild, das sind die Kriege der Zukunft. Smart, unauffällig, chirurgisch, mit beliebiger Reichweite. Nicht töten – ausmerzen. Das Böse ausmerzen. Damit fängt man sie alle. Wo fängt man an? Den Himmel unsicher machen – bei Tag und bei Nacht. Überall und nirgends. Wie hieß die Devise? Bindungen lockern. Nichts lockert Bindungen so sehr wie das Bewusstsein, in jedem beliebigen Moment von einer höheren Macht ausgemerzt werden zu können, die weithin sichtbar oder auch unsichtbar ihre Kreise zieht. Früher hat man so Heilige gezogen, heute zieht man sich Terroristen.«
»Dazu braucht es keine Drohnen. Da genügen ein paar gut verteilte Killer, die zuschlagen und wieder verschwinden. Oder selbst dabei draufgehen draufgehen, falls sie unbedingt möchten. Die Motivation ist der Schlüssel. Eruieren Sie das Motivationsproblem. Ich möchte Ergebnisse sehen, am besten gestern.«
Sieh an, dachte der Mitarbeiter, da verschwindet der Chef für ein paar Tage, keiner weiß wohin, und wenn er wieder auftaucht, hagelt es Aufträge, die bis vor kurzem noch off limits waren.
19
Fac ten Chek hatte den Bürosessel ans Fenster, gerückt, blätterte in einer Broschüre und beobachtete die gegenüberliegende Häuserzeile. Sein Gesicht zeigte die leere Blässe, die Generationen von Verhandlungspartnern entzückt hatte. Der Assistent goss die Blumen und lockerte mit dem Kugelschreiber die Blumenerde. Die neue Sekretärin war nach Hause gegangen, nachdem sie sich dreimal hatte versichern lassen, dass an diesem Nachmittag keine Arbeit mehr für sie anfallen werde.
»Sagen Sie, Chef« – die Stimme des Assistent tönte, als habe sie bereits mehrfach Anlauf genommen und diesmal handle es sich um den Durchbruch, »wenn das letzte Fleckchen Erde gesäubert, der letzte Einheimische geflohen, der letzte Grenzer bestochen, der letzte Politiker umgedreht und der letzte mit Flüchtlingen überfüllte Seelenverkäufer in den Weiten der Südsee gekentert ist: Was machen wir dann? Ich meine, haben wir dafür eine Geschäftsidee ausgearbeitet?«
Das klang, als habe man ihn gerade das Fürchten gelehrt.
20
Fac ten Chek ruhte. Er hatte die Beine übereinander geschlagen und hing Gedanken nach, deren träger Verlauf sich nicht mit normalen Bürostunden vertrug.
»Wieviel Uhr ist es?«
»Zwanzig nach sechs. Erwarten Sie noch Besuch? Im Terminkalender ist nichts weiter eingetragen. Doch, hier, ich sehe, ein Sternchen. Müsste bald soweit sein. Himmel, was ist das?«
Ein Schatten zog am Fenster vorbei, nicht schnell, nicht langsam – so muss Gleiten sein, ging es Fac ten Chek durch den Kopf.
Er stand er auf, wischte ein paar Krümel Blumenerde vom Anzug und stützte sich beidhändig auf die Fensterbank.
»Sehen Sie sich das an«, verkündete er mit beschwingter, fast heiterer Stimme. »Das ist wirklich sehenswert.«
Ein zweiter, ein dritter Schatten bestrich das Büro zwischen zwei Wimpernschlägen.
»Himmel, das sind Marschflugkörper«, platzte der Assistent heraus.
»Man erkennt sie gleich, nicht wahr? Nie gesehen und doch vertraut. So funktionieren wir. Was denken Sie? Furcht? Das hier ist die Antwort auf Ihre Frage. Die einzige, die zählt, was immer Sie davon halten mögen. Wir sind Nomaden, Geschäfte werden vom Sattel aus getätigt, Sie wussten das immer, erinnern Sie sich nicht? An die Arbeit! Vernichten Sie den Inhalt dieses Büros, wir ziehen nicht um, wir ziehen weiter.«
21
Lege den Colt erst dann auf den Tisch, wenn es nötig wird. Fac ten Chek hatte den Western vergessen, in dem dieser Satz fiel, ein Klasse-Western mit Starbesetzung. Er glaubte ihn geträumt zu haben, bevor man ihn damals holte. Wo blieben die Fakten? Selbst wenn es sie gab – irgendwo gab es sie, dessen war er sich sicher –: Wohin mit ihnen? Auf den Tisch –? Auf welchen? Welcher Tisch war der seinige? Dieser hier war es nicht länger, mehr als eine Blumenvase würde er ihm nicht spendieren. Wann immer er Fakten auf jemandes Tisch gelegt hatte, hatte es sich um Sprengstoff gehandelt, sorgfältig ausgesucht und zusammengestellt, geeignet, Menschenleben zu zerstören und Karrieren ›durch die Decke gehen zu lassen‹, wie der unsinnige Ausdruck lautete, den er vor kurzem gehört hatte und gern vergessen wollte. Hatte man ihm jemals Fakten anderer Art präsentiert? Wohl kaum. Sobald einer sagte: »Das sind die Fakten«, hieß es: ›Nimm das und frage nicht.‹
Es war der gute Glaube, der jeglichem Handeln Kraft verlieh.
Welcher Glaube mag wohl der beste sein? Fac ten Chek lachte in sich hinein. Er erkannte die asiatische Praxis wieder, sich gegenseitig Umschläge in die Hand zu schieben, ohne auf den Inhalt zu achten. Ihm war bewusst, welche Sanktionen drohten, wenn etwas damit nicht stimmte. Irgendetwas kommt immer heraus. Ob irgendwann alles herauskam, wie es das Sprichwort wollte, wagte er zu bezweifeln. Er jedenfalls hatte immer guten Glaubens gehandelt. Später, wenn alles gleichgültig wurde, war auch der gute Glaube dahin. Er war nicht schlecht geworden, er war dahin. Lege den Colt erst dann auf den Tisch, wenn es nötig wird. Wenn der Glaube aufgebraucht ist, zeigt sich der Mann. Er trägt Jeans, sein Blick funkelt, er reißt sich die brennende Zigarette von den Lippen und ist bereit. Wozu? Zu einem Gespräch unter Freunden? Dazu ist es zu spät.
Der Assistent rückte näher, seine Augen funkelten und Fac ten Chek staunte: derselbe Glanz, derselbe Satz, dieselbe Absicht. Was für ein Jammer! Sie hätten sich aussprechen sollen.
Ein großes Team – und jetzt lief alles auseinander.