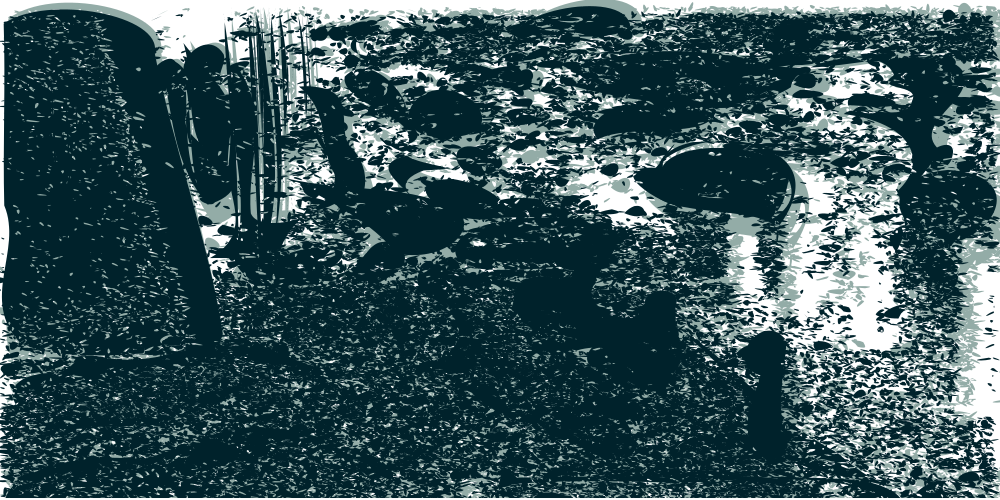Eine konventionelle Erzählung
1.
Ein Mann kauft sich im Netz eine Unterhose und plötzlich steht er als Rechter am Pranger. Das Kündigungsschreiben des Arbeitgebers (ein Reifenhersteller mit Sitz in der Karibik) erreicht ihn drei Tage nach Bekanntwerden des Datenleaks. Die Tochter, klug und anhänglich bis dato, erleidet ein Trauma. Die Mutter nimmt die Gelegenheit wahr und lässt ihm den Umgang mit der Tochter per Gerichtsbeschluss untersagen. Der Richter, ein älterer Mann mit Darmproblemen, hat noch einen Arzttermin.
Mann und Frau leben seit Jahren getrennt. Nun sagt sie sich öffentlich von ihm los. Das habe sie nicht für möglich gehalten. Die Reporterin sendet in Blau und Rosa. Die Aussage reicht ihr nicht, sie hakt nach:
»In all den Jahren haben Sie nichts gemerkt?«
»Wohl«, entgegnet die Frau, »eigentlich nichts Politisches, wir hatten eher andere Interessen, wissen Sie, das Reisen hat uns zusammengeführt. Frisco … die Philippinen… Später musste ich feststellen –«
»Ja?« unterbricht die Reporterin.
»Ja sicher, wir hatten oft Streit über das Urlaubsziel. Eigentlich ganz normal.«
»Aber Sie leben getrennt. Da hat man doch was gemerkt.«
Merkst was? sagt der Bauer zur Kuh, die nicht kalben will. Eigentlich sagt er es mehr zu sich selbst. Er sitzt beim Bier und die Abendsonne ist längst hinterm Horizont versunken.
Das Interview … Ludwig F. entdeckt es, ganz gegen seine Gewohnheit, in einer Werbezeitung. Sie lag im Briefkasten, als habe sie ihn erwartet und brenne darauf, ihm Meldung zu machen. Ein Nachbar, zufällig Zeuge des Vorgangs, alarmiert die Hausgemeinschaft.
Am Schwarzen Brett, gleich neben dem Hauseingang, entdeckt Ludwig F. ein paar Stunden später die nächste Botschaft. »Keine N*zis!« Er liest es auf den Weg nach draußen und findet: Eigentlich könnte das seine Handschrift sein.
Lustig ist das nicht.
Ludwig F. stürmt zurück in die Wohnung, kramt die im Webshop (der Tipp kam vom Nachbar) erworbene Unterhose (Farbe: moosgrün) aus dem ungebügelten Wäschehaufen, zieht sie an und betrachtet sein Bild im Spiegel. Marke: exzellent, Sitz: perfekt. Ein günstiger Kauf. Angeekelt streift er sie ab und wirft sie in den Abfall. Zwischen den Küchenresten schimmert das Grün, als habe er es enttäuscht.
Ganz recht, auch du wirst mir fehlen.
2.
»Diese Ebene unserer Intelligenz ist innerhalb der Gesellschaft breit verteilt; die überwältigende Mehrheit der Menschen besitzt sie, weshalb wir in sozialen Beziehungen so häufig Anstand und Intuition bewundern können, als auch die empfindliche Moral von Menschen, deren intellektuelle Begabungen nur durchschnittlich sind.«
Ludwig F. spürt ein leichtes Beben, als er den Satz überliest, ein zu langer Satz, wie er findet, bei dem Anfang und Ende auseinandergegangen sind wie … wie … nein, er kommt damit nicht klar und legt das Buch zurück auf den Bücherhaufen. ›Intuition‹, das Wort juckt ihn, ein Zeckenbiss könnte nicht unangenehmer wirken. Wozu Bücher, wenn Intuition der alles entscheidende Faktor im Leben ist?
Die Welt der Frauen, findet Ludwig F., ist ihm hermetisch verschlossen. Am Telefon klang die Stimme der Therapeutin ganz nett. Doch lehnt sie es ab, ihn als Klienten anzunehmen, weil er sie als ›Frau‹ angesprochen hat. Sie sei sich über ihr Geschlecht noch nicht schlüssig und komme mit der von ihm vorgenommenen Festlegung einfach nicht klar.
Warum, so fragt er sich, hat seine Intuition schon wieder versagt? Es ist eine rhetorische Frage, das Ergebnis, wie jedes Mal, negativ. Der Krieg in der Ukraine schürt Unruhe in den Gemütern. Nicht ohne Wohlwollen mustert Ludwig F., der gedient hat, die Uniformen in den Abendnachrichten und angelt sich, zum ersten Mal seit langem, einen Kriegsfilm aus der Mediathek. Ein leichter Schlummer holt ihn ein.
3.
An dieser Stelle verlangt die Erzählung eine Zäsur, genauer gesagt, eine Schweigeminute. Der Mensch am Pranger ist eine Institution alten Rechts, die abgeschafft wurde, als sich herumsprach, dass auch der straffällig gewordene Mensch gewisse unveräußerliche Rechte, die Wahrung seiner Person betreffend, besitzt. Die Wiederkehr im Zeichen des Internet – oder ›Netzes‹, wie es hier genannt wird – gehört, auch wenn hier und da staatliche Behörden damit liebäugeln, in den Bereich der Selbstjustiz und damit der Jagd auf Menschen, deren Urheber klug daran tun, sich hinter der Maske der Anonymität zu verbergen. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Das mag sein, doch unter Wölfen gibt es keinen Pranger. Die Bestie Mensch ist immer unterwegs, undercover und unter allen Umständen.
4.
Ludwig F., eingelullt vom Geschützdonner, wacht an der Stelle auf, an der eine als Krankenschwester zurechtgemachte Schauspielerin ihrer Kollegin das Gefühl schildert, das sie (die Krankenschwester) überkam, als sie ansehen musste, wie einem Soldaten (offenbar ein guter Bekannter der beiden) das Gesicht weggeschossen wurde und er noch ein paar Sekunden lang aufrecht stand, bevor er umfiel.
»Nur ein paar Schritte vor mir«, sagt die bebende Synchronstimme und die feste antwortet: »Du trägst keine Schuld.«
Wir kennen dich! Jemand hat es an die Hauswand gepinselt, gleich neben der Eingangstür. Hau ab! Darunter mit Kritzelschrift: Solange noch Zeit ist. Die Hausgemeinschaft ist in Aufruhr. Ludwig F. bedauert, die Unterhose entsorgt zu haben. Er hätte gute Lust, sie aus der Tiefe des Containers wieder hervorzukramen. Zu spät! Die Müllabfuhr war bereits da. Den Twitter-Account hat er gekündigt, doch das hindert sein Handy nicht daran, ihm weiterhin jede Verunglimpfung aus jener Pluster-Welt punktgenau zuzustellen.
Beim Hemdenbügeln probiert er einen Gedanken aus. Vielleicht beziehe ich das bloß subjektiv auf mich? Objektiv gesehen, kann das alles nicht wahr sein. Objektiv gesehen, ganz objektiv gesehen … was ist objektiv? Objektiv gesehen, brennt er gerade ein Loch in den Kragen. Eigentlich müsste er zum Zahnarzt. Aber die Geschlechterfrage hat ihn misstrauisch gemacht. Wer weiß, was die in seinem Mund alles finden.
Ludwig F. bewundert den Präsidenten des fernen und doch so nahen Landes, der unermüdlich den Globus umkreist und an jedem Studio klopft, um Waffen und Geld für sein Land einzusammeln. Der Präsident mit dem Gesicht eines Weichlings scheint ein Liebling der Frauen zu sein. Les extrêmes se touchent. Offenbar macht es ihm nichts aus, am Pranger zu stehen. Vielleicht empfindet er ihn gar nicht. Er ist ein Schauspieler, gewohnt, damit Geld zu machen. Wer Krieg führen will, braucht Geld, viel Geld, er darf nicht wählerisch sein. Dieser Mann hat eine Aufgabe übernommen und führt sie ohne Rücksicht auf Verluste aus.
Ludwig F. stellt sich einen Pranger vor: Auf der einen Seite er selbst, auf der anderen der Präsident. Kaltblütig studiert er die hassverzerrten Gesichter, blickt gebannt in zuckende, lavaspeiende Abgründe und hört die Hosianna-Gesänge von der anderen Seite. Wie lange hältst du das aus? Falsche Frage, tönt es in ihm: Wie lange willst du das aushalten? Du musst die Seite wechseln.
Wem gehört das Medium? Das Medium gehört dem, der es sich zunutze macht. Diese Sprecherin macht Werbung für den Präsidenten. Sie macht es diskret, ihre Stimme bleibt cool, auch sie ist nur Medium, eines im anderen, eine Matrjoschka, gleich springt sie auf und es erscheint die nächste und wieder die nächste, mit einem klitzekleinen Tremolo in der immer noch coolen Stimme. Puppen, Puppen, die Puppen der Geschichte … er begreift … nein, er begreift nichts, außer, dass dort unten Männer gebraucht werden, Männer mit Kampfausbildung wie er.
Männer mit Mut.
Und wenn ich, ich ganz allein, den Unterschied ausmache? Wenn ich das Sandkorn bin, das die Waage zur richtigen Seite hin ausschlagen lässt? Bin ich, ich ganz allein, dann nicht gefordert? Was habe ich schon zu verlieren?
Er reist in jenes fern-nahe Land, als wache er auf. Die Landschaft weit, der Himmel hoch, die Felder endlos, die Sprache der Menschen kraftvoll, der Ton herzlich –: mehr braucht es nicht, um einen Mann wiederherzustellen. Endlich, im Ausbildungscamp, ist er Mann unter Männern. Hin und wieder stößt ihm ein Nazi-Emblem auf, sein Rechtssinn empört sich, dann denkt er an die Hauswand daheim und schluckt die Verletzung hinunter. Nicht alles ist, was es scheint. Ganz überzeugt davon ist er nicht.
Es lebte ein Mann in Ostende,
der dachte, es ginge zu Ende.
Es ging aber weiter.
Das stimmte ihn heiter.
Der Mensch ist ein Kaleidoskop, schüttle ihn und er zeigt sich dir anders.
Das Bild der Front wird Ludwig F. nicht mehr verlassen: ein endloser Schützengraben in schwarzer, krümelig zerfallender Erde. Eine Woche lang liegen sie unter Dauerbeschuss, ohne dass ein Russe sich zeigte. Am Ende der Woche passiert es. Zwei Kameraden, der eine Ukrainer, der andere Usbeke, gehen ›nach oben‹, um eine zu rauchen. Über sich hört er die Stimmen der beiden, verhalten, gelöst, kehlig die eine, fast singend die andere. Eine Insel im Zeitstrom: wo bleibt die Lerche? Im nächsten Moment explodiert eine Granate. Sie reißt dem einen das Gesicht weg (wie im Film, durchfährt es Ludwig F. und wieder hört er die Krankenschwester), dem anderen beide Beine. Sein brechender Blick ist das, was bleibt.
Zwei Tage später befindet sich Ludwig F. auf der Heimreise.
5.
»This ist not the kind of war I expected. This ist world war II combat, really pre-historic.«
Der Fernsehreporter bleibt hartnäckig.
»Did you ever kill a man in combat before?«
»I did. I fought in Afghanistan, in Irak, in Syria. This war is quite a different thing.«
»A word about the Ukrainians.«
»They are heroes. They fight for their country, I mean, it’s their life, they can’t go anywhere.«
Ludwig F. folgt dem Auftritt des Kanadiers schweigend. Als der Kameramann ihn ins Bild holt, wehrt er ab. Zu spät. Deutsche Nazis kämpfen an der ukrainischen Front. Hinter der Grenze erwartet ihn die deutsche Polizei.
6.
Aus dem Gefängnis entlassen, versucht er, niemand zu sein. Wie wird man niemand? Er findet eine Netzseite, die Erfolg zu versprechen scheint.
»Die Toten – oder was wir an ihnen besitzen –, das sind die Wesen, vor denen uns graut, weil sie das Grauen hinter sich haben, unsere zutraulichen Antipoden. Ihr Beharren ist unsere Flucht.«
Nun ja, so kann man es sehen. Aber wenn man es schon so sieht, was folgt daraus? Weiter sinnierend, kommt er zu dem Schluss, dass Tod und Leben ein und dasselbe sind, nur von unterschiedlicher Seite betrachtet. Dieses abgerissene Gesicht, wohin ist es gegangen? Zweifellos ins Nichts, von dem einige sagen, es sei nichts, weil es nicht existiere, während andere darauf bestehen, dass alles nichts ist. Für jemanden, dem man gerade das Gesicht weggeschossen hat, ist diese Aussage sicher zutreffend. Aber kann man sie auch verallgemeinern? Wir erfinden ein Jenseits und setzen das Gesicht dort wieder ein. Was gewinnen wir dabei? Was gewinne ich dabei?
Es ist diese Art von Gedanken, die den Mann – gesetzt, er liest sich als solcher – zur Flasche greifen lässt.
7.
An einem Flüsschen namenst Patowmeck oder Potomac liegt die Hauptstadt des mächtigsten Reiches, das der Planet Erde je gesehen hat, jedenfalls aus menschlicher Perspektive, denn aus Sicht der Flöhe oder Ratten sieht das anders aus, ganz abgesehen vom Weltreich der Viren, das alles durchdringt, was Leben heißt, und niemanden auslässt. In einem Häuschen in jener Stadt am Fluss sitzt ein Mann, den sie den mächtigsten Mann des Planeten nennen, wofür auch sein bescheidenes Auftreten spricht, denn dieser Planet, pardon, ist bloß ein Staubkorn im Universum, aber eines, das den ganzen Unterschied zwischen Sein und Nichtsein ausmacht. Es geht also um Sein und Nichtsein, wenn Mr. Präsident – denn so nennt ihn seine Umgebung – sich von seinem Stuhl erhebt, den Staub aus den Falten seines Anzugs schüttelt und die Stirn in Falten legt, bevor er sich wieder setzt.
Ludwig F. hat ihn nie persönlich getroffen, aber er kennt ihn aus vielen Sendungen – eine radikal asymmetrische Beziehung könnte man nennen, was sich zwischen den beiden tut, denn es ist nicht anzunehmen, dass Mr. President auch nur den Hauch einer Ahnung von der Existenz des anderen besitzt, den eine Unterhose die Existenz kostete. Im Gegenteil, könnte man versucht sein zu formulieren, er würde auch dann noch jede Kenntnis entrüstet zurückweisen, wenn er selbst dieser andere wäre, etwas versetzt auf der Zeitschiene und in anderer Sache unterwegs, so wie Ludwig F. es niemals wagen würde, in die Lebenssphäre des anderen einzudringen, selbst wenn sie ihm sperrangelweit offenstünde.
Umso erstaunter ist Ludwig F., als er erfährt, dass Mr. President an einer mysteriösen Krankheit leidet, genannt Alter, und dass diese Krankheit ihn – und die Welt mit ihm – die Existenz kosten könnte.
Kann man ihn denn nicht davor schützen? Und wenn das schon nicht gelingt – kann man nicht die Welt vor ihm schützen?
Komische Frage: Wie soll man die Welt vor dem Beschützer der Welt schützen? Und wenn schon die Frage, für sich genommen, paradox ist – wie kann dann etwas anderes herauskommen als eine Paradoxie, so ungeheuer wie die Welt oder ihr Nichtsein selbst? Wenn aber – Ludwig F. fühlt ein Beben in ihm aufsteigen wie einst in der Buchhandlung –, wenn aber der Beschützer der Welt kein Beschützer ist, sondern ein Machthaber und -mehrer wie alle anderen auch, dann, ja dann… Dann wäre die Welt ja ganz und gar ungeschützt nur sich selbst überlassen und alles wäre nur Macht und Machtrausch und ein kleiner mentaler Kollaps würde genügen… Das Argument, fühlt Ludwig F., dreht sich im Kreis. Die Welt will von der Allmacht gerettet werden, nicht vor ihr. Doch dazu muss sie allmächtig sein. Der Ernst der Lage lässt keine halben Sachen zu. Wer sich der Allmacht in den Weg stellt, der muss zerstört werden. Er ist der Widersacher.
Und wenn der Allmächtige krank ist?
Mit klammen Fingern tippt Ludwig F. seine Frage ins Netz: Kann der Allmächtige krank sein?
Mit den Antworten hat er nicht gerechnet.
Wie krank bist du denn?
Der Allmächtige wird dich finden und vernichten.
Komm runter von deinem Hochmut oder du bist ein toter Mann.
In Ewigkeit, Amen.
Von welcher Allmacht faselt der Kerl?
Ein Fall für die Psychiatrie.
Ich weiß genau, was du meinst. Wir müssen uns treffen.
Allmächtig ist nur das Böse.
Bist du der Versucher oder was? Such dir einen anderen Job.
Ist Ludwig F. fromm? Er weiß es nicht, hat es nie gewusst. Familie und Beruf haben ihn nicht dazu kommen lassen, sich mit der Frage zu beschäftigen, und heute, das weiß er mit Bestimmtheit, ist es dafür zu spät. Er könnte sie so oder so beantworten, beides erzeugte in ihm keinen Widerhall. Es wäre gelogen. Warum soll einer wie er sich belügen? Er könnte die Frage offenlassen, aber auch das wäre eine Lüge.
Der Ludewig, der Ludewig,
Der ist ein arger Wüterich.
8.
Ludwig F. schreibt an den Papst.
»Ich bin 38 und möchte die Welt retten. Ich habe es schon einmal versucht und dabei festgestellt: Die Welt lässt sich nicht retten. Ich könnte es bei dieser Feststellung belassen, aber dann wäre ich mitschuldig, sollte die Menschheit im atomaren Schlagabtausch untergehen, und das kann nicht in Ihrem Sinne sein. Sie allein können diese Schuld von mir nehmen. Ich weiß, ich bin ein fehlbarer Mensch und mein Karma ist vielleicht nicht so gut wie das Ihre. Jedoch die Welt hat es nicht verdient, in einem ukrainischen Schützengraben zu enden. Weder ich noch Sie noch irgendein anderer Mensch hat es verdient, so zu enden, ich meine, ohne versichert zu sein, dass das Schicksal der Welt in sicheren Händen liegt und der eigene Tod dazu da ist, dass es dabei bleibt. Keiner Sache gedient zu haben ist fataler als der falschen gedient zu haben. Schlimm, schlimm. Keine Sorge, ich halte Sie nicht für allmächtig. Aber Ihre Kirche ist reich und Reichtum regiert die Welt. Die Pflicht der Reichen ist es, die Welt zu retten. Machen Sie mich reich und ich hebe das Böse aus den Angeln, so wie Archimedes es gesagt hat: Gebt mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Ich bin überzeugt davon, Sie kennen den Punkt. An meinem Gehirn dagegen, oje! … kratzt ein Jazzer, der mich davon abhält, ihn zu erreichen.
Ein Wort zum Abschied: Ich weiß, es steht nicht in Ihrer Macht, mich reich zu machen. Es steht auch nicht in Ihrer Macht, Ihren Reichtum einzusetzen, um die Welt zu retten. Reichtum ist Reichtum und die Welt ist die Welt. Ginge die Welt nicht zu Grunde, wäre Ihr Reichtum nichts. Niemand macht sich ungestraft zum Herrn über das Böse. Das gilt übrigens auch für die Psychiatrie. Dass ich Ihnen schreibe, ist bloß Nostalgie. Machen Sie sich nichts draus.
Ihr
Ludwig F.«
9.
»Huz, huz«, lächelt der Papst und verdreht die Augen gen Himmel. »Wieder ein Gerechter weniger. Wo soll das enden?«
Damit verschwindet Ludwig F. aus der Geschichte. In rechten Kreisen wird kolportiert, auf einem Karolinger-Kongress habe ein eingedrungener salafistischer Messerschwinger seinem Leben mit einem brachialen Stoß ins Gesicht ein Ende gesetzt. Ein Polizist, der dazwischenging – übrigens muslimischen Glaubens –, habe schwer verletzt überlebt. Doch von beidem findet sich in der seriösen Berichterstattung keine Spur.