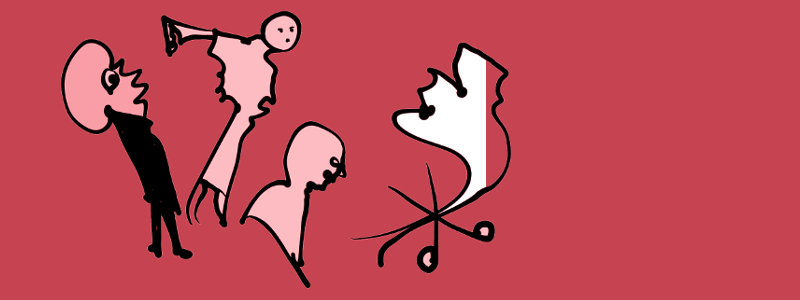Freiheit wird heute allgemein als ein gesellschaftliches, politisches und soziales Problem erfasst – immerhin als »Problem« erkannt. Aber das greift noch zu kurz. Freiheit lässt sich, weil sie nach unserem menschlichen Maß allumfassend scheint, in keine eindeutige Definition, demzufolge in keine Zwangsjacke stecken. Das wäre nicht nur nicht angemessen gegenüber dem stolzen Wort Freiheit, das seit jeher viele Menschenopfer forderte und fordern wird, sondern spielte nur einer anderen Einseitigkeit in die Hände, die Theodor W. Adorno so ausgedrückt hat:
Freiheit ist einzig in bestimmte Negation zu fassen, gemäß der konkreten Gestalt von Unfreiheit.
Es soll zwar in diesem Satz mehr gesagt sein, als nur auf die Kehrseite der Medaille hinzuweisen, aber ich möchte mich hier in Dresden nicht zu sehr in abstrakte Details verlieren, sondern ich darf, dem Titel der Veranstaltung gemäß, ganz ungeniert über jene Freiheit reflektieren, die ich ganz persönlich meine. Das kommt mir äußerst entgegen, ohne mich hinter Johann Gottlieb Fichtes Begriff des »absoluten Ichs« verbarrikadieren zu wollen, denn dieses absolut gesetzte Ich ist nicht mit dem individuellen Geist zu verwechseln, um den es mir als Schriftsteller gehen müsste, nähme ich es mit mir und der Kunst nur ernst genug.
Wer wie ich und viele hier im Raum in einer marxistisch grundierten Diktatur aufgewachsen ist, kennt die anmaßende »Objektivität«, derer sich die selbstherrlich herrschenden »Führer der Arbeiterklasse« zur Rechtfertigung ihrer Machtansprüche bedienten. Die Begründung ihrer Objektivität verstieß gegen jeden gesunden Menschenverstand samt aller Logik, denn schon bei Lenin hieß es bekanntlich: Die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist. Und warum glaubten die Einheitssozialisten so penetrant an die Wahrheit dieser marxistischen Weltanschauung? Weil diese sie schamlos dazu ermächtigte, sich allmächtig zu fühlen. Noch 1987 hieß es in einem Buch des Aufbau-Verlags zu Werner Krauss: Die Parteilichkeit des Marxismus-Leninismus kann sich jederzeit auf die volle Deckung der Wahrheit berufen. Bei solchen Spreng-Sätzen bar jeder Vernunft sollte man voll in Deckung gehen.
Als ich zwischen 1959 und 1964 hier in Dresden zur Kinder- und Jugendsport-Schule gehen durfte, glaubte ich noch, dass Karl Marx die Geschichtsgesetze erkannt und damit das Rätsel der Weltgeschichte gelöst habe. Da schien mir die Welt noch heil, die Zukunft rosig. Im praktischen Jahr nach dem Abitur bat ich sogar um Aufnahme in die SED. Zum Glück ließ mich mein Hang zur Kunst, der ja nicht selten das Wahrnehmungsvermögen schult, immer weiter von meinem »objektiven Glauben« an das kommunistische Paradies auf Erden abkommen. Nicht zufällig hieß mein erster Roman, an dem ich zwischen 1968 und 1969 schrieb, »Der Freischwimmer«. Es versteht sich von selbst, dass er nie in der DDR veröffentlicht wurde, deshalb kam er erst 19 Jahre später im Westen Deutschlands heraus.
Übrigens habe ich in meiner Jugend auch gern gemalt, zusammen mit meinem Schulfreund Klaus Jugelt aus Weinböhla, der zeitweise sogar als FDJ-Sekretär fungierte, waren wir die »Künstler« an der Sportschule. Ich malte ziemlich expressiv und bekam dafür immer die besten Noten vom Zeichenlehrer Stein. Aber eines Tages, es könnte im Jahre 1962 gewesen sein, hob er wie Wilhelm Buschs Lehrer Lämpel den Zeigefinger, also aufgesetzt und wenig überzeugend, und erklärte uns, dass Expressionismus »spätbürgerliche Dekadenz« sei und »Deformierung des Menschenbildes« bedeute, also keinesfalls vereinbar mit dem sozialistischen Realismus wäre. Während die Bevölkerung schon wie unter den Nationalsozialisten von dieser »entarteten Dekadenz« verschont bleiben sollte, ließ man im Leipziger Seewald-Verlag Bücher über die Dresdner Brücke-Maler drucken, jedoch nur für den Westexport.
Ich will nicht verheimlichen, wie mich vor allem der illegale West-Import in Form von Büchern und Zeitschriften beeinflusste, die wir entweder auf der Leipziger Buchmesse als geistigen »Mundraub« entwendeten oder die mutige West-Besucher über die Grenze schmuggelten. Später saß ich monatelang bis zu meiner 1. Inhaftierung 1971 sogar als Nachtpförtner der Deutschen Bücherei in Leipzig gewissermaßen an der Quelle. Was da so aus dem »freien Westen« herüber quoll, war vor allem eine Vielfalt linker Theorien und Utopien von Maoisten, Trotzkisten, Leninisten, Castro-, Che Guevara- und Hoxha-Anhängern, die aber untereinander in solchen heftigen Streit geraten waren, dass man staunte, wie sich Marxisten und Anarchisten verschiedenster Ausrichtung so brutal bekämpfen konnten, als ob sie den bürgerlichen Klassenfeind darüber ganz vergessen hatten.
Während wir noch im Halbschatten des »Prager Frühlings« naiv an den Sozialismus mit »menschlichem Antlitz« glaubten, schritten die Wessi-Revolutionäre bereits zur Tat, drängten zum revolutionären Kampf. Jeder fünfte Bundesbürger soll damals, will man den Umfragen trauen, bereit gewesen sein, den marxistisch inspirierten Terroristen der Baader-Meinhof-Bande Unterschlupf zu gewähren. In Zeiten des größten Volkswohlstandes in der Bundesrepublik zeigte das Barometer revolutionären Sturm an.
Die Kapital- und Produktionsmittelbesitzer sollten enteignet und das Privateigentum abgeschafft werden. Man versuchte den »Mann in blauer Bluse« (Fritz Weichelt) zur Revolution anzustacheln. Religion, das »Opium des Volkes«, sollte sich verflüchtigen. Von vielen Kanzeln wurde bald im marxistischen Kauderwelsch das Paradies auf Erden verkündet. Die Familie als Keimzelle der bürgerlichen Gesellschaft galt es aufzulösen. »Omas Ehe ist tot!« Oder: »Wer zweimal mit der Selben pennt, gehört schon zum Establishment!«. So hießen zwei der markanten Sprüche. Schließlich wären alle staatlichen Strukturen hinfällig werden, da die kommunistisch befreiten Menschen selbstverantwortlich und harmonisch miteinander leben würden. Nicht nur der Staat mit seinen Repressionsinstrumenten wie Polizei und Justiz würde »absterben«, sondern es gäbe auch keine bürgerliche Arbeitsteilung mehr, da sich im Kommunismus nicht nur jedermann an jedem Ort einmal in der Woche mit Sport in jedem beliebigen Zweige ausbilden kann, weil die Gesellschaft die allgemeine Produktion regelt und mir eben dadurch möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, ohne je Jäger, Fischer, Hirte oder Kritiker zu werden.
Ich nahm mir die Freiheit, ab der 11. Klasse solche An- und Aussichten ernst zu nehmen, denn wenn wir ohnehin bald im Kommunismus leben, so meine damalige Logik, warum soll ich mich da noch mit Chemie, Physik und Mathe herumquälen, wenn ich doch schon wusste, was ich unbedingt werden wollte, nämlich Künstler? Entsprechend sah mein Zeugnis aus: überwiegend Einsen auf der einen und Vieren auf der anderen Seite.
Kurz vor dem Abi erschreckte mich ein Lehrer, der ebenfalls mal seine Nase in Schriften von Marx gesteckt hatte, mit einem Zitat, das so begann:
Die exklusive Konzentration des künstlerischen Talents im Einzelnen und seine damit zusammenhängende Unterdrückung in der großen Masse ist Folge der Teilung der Arbeit. Und dieser Absatz endet konsequent mit der Behauptung: In einer kommunistischen Gesellschaft gibt es keine Maler, sondern höchstens Menschen, die unter Anderm auch malen.
In den Reifejahren durchschauten nicht Wenige zunehmend die Ungereimtheiten jener Autoritäten, die uns ins Paradies führen wollten, so dass es einem oft nur vergönnt schien, in utopische Welten zu fliehen oder in äußerste Subjektivität, in Trotz oder Resignation, in zynische Anpassung oder mit der Flucht aus dem eigenen Leben. Der glückliche Rest ließ sein Wahrnehmungsvermögen degenerieren, um fröhlich und unbelastet von bürgerlicher Moral volkseigenes Material für seine Datsche aus den proletarisierten Fabriken herauszuholen. Und wer es zum Meister der Selbstbeschränkung brachte nach der alten buddhistischen Devise »Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen«, der konnte in beiden deutschen Despotien fröhliche Lieder trällern. Und mancher begabte Künstler schaffte es gar, sich zum Hofnarren verschiedener Parteifürsten zu qualifizieren. Das ermuntert sie nun in der Demokratie dazu, Fundamentalkritik anzumelden und die Systemfrage zu stellen, weil sie ja auch schon unter der Diktatur des Proletariats kritisch gewesen seien, was sogar stimmt. Ja, kritisch waren sie durchaus, nur dagegen waren sie nie. Sie wollten das Kapitalverbrechen, was der Bolschewismus, auch Kommunismus oder Sozialismus geheißen, von allem Anfang an war und bis zuletzt blieb, lediglich verlängern mittels leichter Versüßung zwecks längerer Haltbarkeit. Aber nicht einmal dazu waren noch die Mittel da, wenn man dem vertraulichen Schürer-Bericht zur ökonomischen Lage der DDR glauben darf, der im Herbst 1989 fürs Politbüro erstellt wurde: Das bestehende System der Leitung und Planung hat sich trotz großer Anstrengungen zentraler und örtlicher Organe nicht bewährt. Allein ein Stoppen der Verschuldung würde im Jahre 1990 eine Senkung des Lebensstandards um 25 bis 30 Prozent erfordern und die DDR unregierbar machen.
Hätten sensible Geister nicht schon viel früher die Ansätze dieser geistigen, ethischen und moralischen Verwüstungen erkennen müssen, die ihre Entsprechungen so deutlich in der sichtbaren Welt des real existierenden Sozialismus hatten? Oder war sie etwa nicht zu sehen, nicht zu riechen, nicht zu erfahren diese rücksichtslose Ausbeutung des Bodens samt der Wasser- und Luftverschmutzungen? War es nicht zu erkennen, das überdimensionale Waldsterben im Erzgebirge? Warum hat keiner einen Einspruch gegen das Zerfallenlassen der wertvollen Altbausubstanz gewagt oder gegen die hässliche und miserable Bauausführung in den Neubaugebieten? Hatte niemand etwas mitbekommen von der Allgegenwart des allmächtigen Geheimdienstes mit seinen polizeilichen Befugnissen und 17 eigenen Untersuchungshaftanstalten? (Nur zum Vergleich: die Gestapo umfasste fürs gesamte Deutsche Reich 7.000 Mitarbeiter; die kleine DDR brauchte zuletzt über 93.000 hauptamtliche und an die 189.000 inoffizielle Mitarbeiter. Dabei sind die vielen Kaderleiter und -leiterinnen als ziviler Außenposten der Stasi gar nicht mitgezählt.)
Sah niemand mit Entsetzen die chaotischen Produktionsbedingungen in den so genannten volkseigenen Betrieben, nichts von der armseligen medizinischen Versorgung und kulturellen Betreuung der meisten Lohnempfänger? Und die so offensichtlichen Parallelen zur NS-Diktatur, die Verhinderung freier und geheimer Wahlen bis hin zu simpelsten Wahlfälschungen, die permanente Verletzung der Menschenrechte, die Terrorjustiz gegen Andersdenkende, ohne Öffentlichkeit und Rechtsbeistand. Eine Viertelmillion politischer Gefangener wurde nie zum Thema der Chronisten dieser wunderbaren Jahre. Ebenso wenig die primitive Indoktrinierung samt Geschichtsfälschungen in allen Lese- und Geschichtsbüchern, die Erziehung zum Hass und das Erschießen von wehrlosen Flüchtlingen, das große Einmauern 1961, all´ diese kommunistischen Alltäglichkeiten sollte keiner der Dichter und Denker wenigstens intuitiv durchschaut und wenigstens für die Schublade gestaltet haben?
Die bis zuletzt der DDR die Treue hielten, sie besaßen keine Tiefe, in der etwas zu verbergen gewesen wäre. Nach dem, was sie Wende nennen, kam nur zum Vorschein: Ihr Freiheitsbewusstsein war genauso verkümmert wie ihr Wahrnehmungsvermögen, aber sie besaßen den Schutz und ein paar Versorgungsprivilegien ihrer Partei, die ihnen stets sagte, wo es lang geht. Und manche von ihnen haben auch einmal sanft einem Dissidenten ein Bein gestellt, um sie vor dem Zuweitgehen zu warnen.
Nun sind sie, die Apostel des Fortschritts auf ihren marktwirtschaftlichen Wert herabgesunken, das ist das eine. Das Schlimmere ist, dass sie nun wie die Stasi-Offiziere, Kaderleiter, SED-Funktionäre und wie so viele andere Feindbildeinpeitscher und Klassenkämpfer ihre privilegierten Renten aus dem Generationsvertrag der ausgebeuteten Arbeiterinnen und Arbeiter der BRD empfangen müssen, weil ihr Staat ihre Renten veruntreut hat, um es gelinde auszudrücken.
Angesichts solcher Demütigung bin ich fast bereit, Mitleid mit meinen ehemaligen Peinigern zu empfinden. Dazu kommt ja noch, dass die von Hans Modrow eingerichtete und dann von den »kapitalistischen Haien« ausgenutzte Treuhand-anstalt die wertvollen volkseigenen Betriebe ruinierte. Wen interessiert es denn heute noch, dass damals 40 % aller Beschäftigten des VEB Chemiekombinat Leuna nur in der Instandhaltung dieses Schrottunternehmens tätig waren? Aber das war kein Thema für die künstlichen - Pardon! - künstlerischen Chronisten ihrer Zeit. Auch die Berliner Mauer, die mancher sensible Künstler schon zu seinem Brett vorm Kopf verinnerlicht hatte, war kein Thema der Empörung. Ebenso wenig die ach-so-friedliebende Erziehung des Nachwuchses, der in den Hoch-Zeiten der Entspannungspolitik mit martialischem Liedgut aufwuchs und demzufolge während der Schulzeit schon den Soldatenberuf erlernen und möglichst für die Offizierslaufbahn geworben werden musste.
Der 1982 aus dem Zuchthaus Brandenburg freigekaufte Andreas Schmidt analysierte einmal die Lese- und Liederbücher der DDR zu Beginn der 80er Jahre und kam zu folgendem Ergebnis: Im Lehrbuch der Klassen 5/6 sind von insgesamt 67 Lieder nur 25 kriegerisch. Das Verhältnis ändert sich rapide, durchforstet man das Buch 7/8. Hier gibt es im Ganzen 68 Lieder. 47 davon rufen zum Kampf. Und in den Klassen 9/10 sind es 41 von 57. Häufig vorkommende Schlagworte sind: »Vorwärts, Marschtritt, Sturmschritt, Soldat, Gewehr, Sturmtag, Waffe, Schwur, Kampf und Ruhm, Hurra, Sturm, Feldzug, Stolz, Feind, Lager, Held, Kanonen, Kolonnen, Kugeln« und das allgegenwärtige »kämpfen«, das in jedem der analysierten Lieder 1,6 mal erschallt, in einem Lied sogar 16 mal.
Künstler von Rang und Namen wie Christa Wolf, Volker Braun oder Stefan Heym kreierten im November 1989, als die Leipziger oder Dresdner Demonstranten schon riefen »Wir sind ein Volk!« oder »Deutschland, einig Vaterland!«, einen Aufruf »Für unser Land«, in dem sie sich auf eine sozialistische Alternative zur Bundesrepublik beriefen und sich gegen den Ausverkauf ihrer materiellen und moralischen Werte und gegen die Vereinnahmung durch die Bundesrepublik sträubten. In ihrem eigenen marxistischen Sprachgebrauch hieße solch’ freiheitsfeindliches Denken »reaktionär« und »konterrevolutionär«. Ich möchte ja als Faust nicht aufs Auge zielen, aber ein Zitat Marie von Ebner-Eschenbachs kann ich mir doch nicht verkneifen: Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit.
Wer sich hingegen nach langem inneren Ringen oder vielen Irrwegen frei und willig zum Bürgertum bekennt, kann sich nicht mehr nur in der Polemik erschöpfen, sondern versucht die Welt zu verstehen, zu interpretieren. Und so kann ich gut unterstreichen, was der Philosoph Odo Marquard, der bekanntlich mehr Mut zur Bürgerlichkeit einforderte, in einem Interview so ausdrückte: Nicht die Moderne ist verhängnisvoll, sondern der Antimodernismus. Nicht die Bürgerlichkeit ist falsch, sondern ihre Verweigerung: die Romantik der Revolution oder des Ausnahmezustands. Vernünftig ist, wer den Ausnahmezustand vermeidet, wer statt für die Utopie für die menschliche Endlichkeit und für ihre Kompensationen eintritt.
Wer für etwas eintritt, braucht Rückendeckung; nicht durch Machthaber und ihre Büttel, sondern durch Erkenntnisse, die durch Erfahrungen gekeltert wurden und gut abgelagert sind. Sich seiner Erfahrungen bewusst zu werden, heißt, in die Vergangenheit zu schauen, nicht aus nostalgischen Gründen, sondern weil wir kein wesentlicheres Maß haben, mit dem wir unsere menschliche Endlichkeit überblicken können. In erster Linie für uns selber, aber auch, um allgemein für das Individuum und seine Eigenheiten den Sinn zu schärfen, für die lieben Mitmenschen und ihre Gebrechen, für uns Kreaturen und unsere fragilen Freiheiten. Dass die Freiheitsliebe der Deutschen im Schwinden ist, wer könnte sich denn darüber freuen?
Jahrelang wurde in der DDR geschuftet, was man jedenfalls gern so bezeichnete, und Vieles, was es ohnehin nicht gab, vom Munde abgespart, damit man sich einen zehn Jahre alten Trabbi zum Neupreis leisten konnte. Und dann ab an den Balaton! Damit man sich im Bruderland Ungarn ohne Westgeld nicht allzu sehr blamierte, schleppte man Büchsen und Konserven mit, dass sich die Trabbi-Achsen bogen. Der »sozialistische Biedermeier« wurde einst treffend von dem Berliner Satiriker Kurt Bartsch beschrieben:
Immer glauben, nur nicht denken
und das Mäntelchen im Wind.
Wozu noch den Kopf verrenken,
wenn wir für den Frieden sind?
Freiheit und Frieden, das wäre auch so eine Überschrift, zu der es sich trefflich philosophieren ließe. Doch zu diesem Thema ist wohl Karls Jaspers kaum noch zu überbieten, der bündig schrieb: Friede ist nur durch Freiheit, Freiheit nur durch Wahrheit möglich.
Neben der Lektüre des nordamerikanischen Dichters Walt Whitman und des Sängers Bob Dylan verhalf mir das neue Programm der tschechoslowakischen Reform-Kommunisten von 1968, das ich mir über »Radio Prag« zusenden ließ, zu meinem bis dahin stärksten Freiheitsempfindungen. 1968, das war die unvergessliche Zeit, als Wolf Biermann, der Kritiker des realen und Lobsänger des humanen Sozialismus, in dieser Situation um sein Leben fürchtete und sich versteckte, während seine Jünger, darunter Funktionärssöhne wie der spätere Schriftsteller Thomas Brasch oder die Söhne des Dissidenten Professor Robert Havemann oder die Liedermacherin Bettina Wegner, in Berlin die tschechoslowakische Flagge hissten und Flugblätter verteilten. Andere schrieben lediglich wie der spätere Kabarettist und Schriftsteller Bernd-Lutz Lange »Dubcek« an Häuserwände und wurden ins Gefängnis gesteckt oder zu Spitzeldiensten erpresst. Die Intervention war auch für den aus dem Vogtland stammenden Bernd Eisenfeld ein Schock. Er schrieb der tschechoslowakischen Botschaft: Halten Sie Stand – Behalten Sie Hoffnung. Auf einer Schreibmaschine stellte er Flugblätter mit Lenin-Zitaten her, die er in Halle verteilte. Er wurde verhaftet und zu 30 Monaten Freiheitsentzug verurteilt.
Die Älteren unter uns dürften sich erinnern: Im Mai 1968 wurde auf Geheiß Walter Ulbrichts in Leipzig die 1240 geweihte Paulinerkirche gesprengt, weil das Gotteshaus, das über 400 Jahre als Aula, Begräbnisstätte und Ort akademischer Feierlichkeiten das geistige Zentrum der Universität war, Kommunisten provozierte. Dietrich Koch wurde bei einer Protestansammlung vor der Kirche festgenommen und von der Deutschen Akademie der Wissenschaften, in der er als Physiker arbeitete, fristlos entlassen. Bald danach entrollte sich zum internationalen Bachwettbewerb in der Leipziger Kongresshalle in Anwesenheit hoher Funktionäre automatisch ein Plakat mit einer Zeichnung der Kirche und der Aufschrift »Wir fordern Wiederaufbau«. Koch hatte zusammen mit seinem Bruder Eckhard Koch den Wecker-Auslösemechanismus gebaut. Nachdem die Initiatoren Welzk und Fritsche in den Westen geflohen waren, verhaftete der Staatssicherheitsdienst zwei Jahre später mehrere Leipziger. Sie wurden durch einen westdeutschen Linken bei der Stasi denunziert. Dietrich Koch ist der einzige wegen dieses Plakatprotestes Verurteilte und hat in dem hier in Dresden verlegten dreibändigen Werk »Das Verhör. Zerstörung und Widerstand« berichtet, wie die Stasi in einem zweijährigen Ermittlungsverfahren dieses »Verbrechen« aufzuklären suchte.
Das MfS hatte 1968 im wahrsten Wortsinn alle Hände voll zu tun. Leipziger Medizinstudenten weigerten sich, Blut für Vietnam zu spenden, was natürlich ihre Strafversetzung in die Produktion bewirkte. Schauspielstudenten erlaubten sich, ein pazifistisches Pamphlet zu verfassen, ausgerechnet in diesem Jahr des verschärften Klassenkampfes, wo die Funken der Rebellion nicht nur aus dem Westen, sondern auch aus dem Osten ins Musterländle des Sozialismus stoben. Dass die männlichen Studierenden zur Armee eingezogen wurden, versteht sich von selber.
Und dann gab es noch diese »Lyrik-Spinner«, wie Stasi-Offiziere sie zu nennen pflegten. Da Ulbricht ängstlich erwog, das renommierte Literatur-Institut in Leipzig zu schließen, das Diplomschriftsteller unter privilegierten Bedingungen heranzog, wurde dort schon im Frühjahr eine Säuberungswelle eingeleitet, der fast ein Drittel der Studenten zum Opfer fiel, darunter auch ich. Aber wir nach freiem Ausdruck suchenden Jungpoeten ließen uns nicht entmutigen, sondern missbrauchten ein volkseigenes Ausflugsboot auf einem Stausee zu einer Lyrik-Lesung. Unter den Anwesenden war Heide Härtl, die 1988 illegal den »bergen-verlag« als ersten unabhängigen Verlag der DDR gründete; ihr damaliger Mann, der spätere Uwe-Johnson-Preisträger Gert Neumann; der Lyriker und Erzähler Kristian Pech; der spätere Gebrüder-Grimm-Preisträger Andreas Reimann (der 1968 als erster aus dem Freundeskreis verhaftet und wegen staatsfeindlicher Hetze zu zwei Jahren Haft verurteilt wurde); Bernd-Lutz Lange (der vor allem durch den Aufruf der »Leipziger Sechs« bekannt wurde und dazu beitrug, dass die Montagsdemonstration am 9. Oktober 1989 mit über 70.000 Teilnehmern friedlich verlief) oder die Maler Dietrich Gnüchtel und Michael Flade (der aus Dresden stammt und ebenfalls übers Gefängnis in den Westen freigekauft wurde, sich aber dort, entsetzt über die linke Kulturszene, 1984 das Leben nahm), sowie ich, der ich damals als Motorbootfahrer die Aktion steuerte und mit Zitaten aus dem Programm der Prager Reformkommunisten die »Riverboatparty« anheizte.
Die Gedichte des späteren Büchner-Preisträgers Wolfgang Hilbig nahmen auf dem Boot »den größten Raum der Diskussion« ein, wie der smarte Dichter, Student und aus Magdeburg stammende Domprediger-Sohn Odwin Quast nachträglich seiner »Firma« berichtete, für die er bis zum Ende als inoffizieller Mitarbeiter tätig war: Die zahlreichen Gedichte Hilbigs haben fast durchgehend den gleichen Inhalt: das nicht Zurechtkommen in dieser Gesellschaft, das sich ausgestoßen fühlen. Daraus resultieren dann verallgemeinerte Angriffe gegen diesen Staat, seine Gesellschaftsordnung und seine Menschen (...) Ein Grundthema seiner Lyrik ist die Deutschlandproblematik ausgehend von einem imaginären Deutschland, wobei er die tatsächlichen Grenzverhältnisse mutwillig missachtet.
Während wir damals mit dieser ungenehmigten Lesung schon an die Grenzen unserer ohnehin unerlaubten Freiheit stießen, hatte man 1968 im »freien Westen« ganz andere Probleme, zum Beispiel in Wien. Dort machte im Juni eine Revolte der besonderen Art von sich reden. Im Hörsaal 1 der Universität Wien fand eine Aktion unter dem Titel »Kunst und Revolution« vor rund 300 Zuschauern statt und wurde von den Aktionisten Brus, Export, Muehl und Wiener ausgeführt. Die nahezu vollständig versammelten Hauptdarsteller des Wiener Aktionismus brachen dort gleich mehrere Tabus: Nacktheit, das Verrichten der Notdurft, Masturbation, Auspeitschen, Selbstverstümmelung, das Verschmieren der eigenen Exkremente am nackten Körper und das Erbrechen durch Reizung der Speiseröhre – all’ das unter dem Absingen der Nationalhymne auf der ausgebreiteten österreichischen Nationalflagge. Die von Journalisten aufgeschreckte Öffentlichkeit prägte lediglich den Begriff »Uni-Ferkelei«.
Die vor allem in Paris ausgelöste »Studentenbewegung« griff auf andere Länder über, besonders auf die Bundesrepublik. Diejenigen, die gegen den »Muff von 1000 Jahren unter den Talaren« anrannten, hüpften bald infantil mit Ho-Ho-Ho-Chi-Minh-Geschrei durch die Straßen und streckten die Konterfeis kommunistischer Massenmörder in die Höhe. In den Familien des kaum noch vorhandenen Bürgertums verkehrten sich die Moralnormen der Wohlstandskinder zu einer selbstgerechten Kritik an der Elterngeneration. Eine sogenannte »vaterlose Generation« wuchs durch die Kriegsfolgen heran und nutzte die Schuldgefühle der gedemütigten Generation, die Hitler nicht nur nicht verhindert, sondern angeblich sogar gewählt hatte, brutal aus. Insbesondere der Vietnamkrieg bot den Ansatz zur »Entlarvung« des von vielen Jugendlichen als unerträglich empfundenen Widerspruchs zwischen märchenhaften Idealen und der desillusionierenden Realität westlicher Demokratien.
Ein Blick über den Tellerrand hinaus in Richtung Osten hätte sie eines Besseren belehren können, wenn man schon solch integeren Persönlichkeiten wie Jean-Maria Lustiger keinen Glauben schenkte, der sich einst als Jude vor den Nationalsozialisten verstecken musste, 1940 zum Katholizismus konvertierte und 1983 zu Kardinalswürden gelangte. Als Chef der Pariser Studentenpfarrer erlebte er 1968 die Revolte, an deren Spitze der heutige EU-Parlamentarier Daniel Cohn-Bendit stand, und Lustiger erkannte sofort die Richtung, aus der diese Bewegung kam: Hohle Phrasen, verbaler Radikalismus. Dieses Wiederaufleben des Irrationalen ist eine Spiegelung des Nazismus.
Ob Missbrauch der Freiheit oder Angst vor der Freiheit, ob Verachtung derselben oder ihre Unterdrückung im Namen des Friedens oder anderer angeblich übergeordneter Werte, die Ambivalenz, die wohl aller menschlichen Natur und Kultur zugrunde liegt, macht auch vor der Freiheit und ihren Ausdrucksmöglichkeiten in der Sprache keinen Halt.
Als zwiespältig dürfte auch mein Verhältnis zu Dresden bezeichnet werden, was ich frank und frei der Stadt zu ihrer 800-Jahrfeier ins Stammbuch schrieb, das den Titel trägt: »Dichter über Dresden«. In Dresden durfte ich 1964, damals noch als Arbeiterkind geführt und gefördert, auf der Kinder- und Jugendsportschule (KJS) mein Abitur ablegen. Zehn Jahre darauf wurde ich nach einer halbjährigen Einzelhaft auf der Bautzener Straße vor dem Bezirksgericht Dresden wegen »staatsfeindlicher Hetze« zur damals gültigen Höchststrafe für Nichtvorbestrafte, nämlich zu viereinhalb Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Staatsfeindliche Hetze galt offiziell als ein Verbrechen. Wiederum ein Jahr darauf ließ Honecker, gewissermaßen als Begleitmaßnahme zur KSZE-Konferenz in Helsinki, die politischen Strafgesetze drastisch verschärfen, obwohl es ja eigentlich gar keine politischen Gefangenen in der DDR gegeben haben soll.
Die herrschenden »Ersatzrussen«, wie der Ex-Funktionär und ehemalige Marxismus- und Wirtschaftsprofessor Hermann von Berg seine Genossen gern zu bezeichnen pflegte, nahmen sich nach Görings Motto »Wer Jude ist, bestimme ich!« die Freiheit, diejenigen zu Verbrechern zu stempeln und dementsprechend zu behandeln, die sie an ihre eigenen Versprechen, Visionen und unterschriebenen Verträge erinnerten. Hätten wir damals schon mehr über den Kronstädter Matrosenaufstand gewusst, dann hätten viele junge Idealisten gar nicht erst um Aufnahme in die SED gebeten. (Es ist eine Mär, dass nur Karrieristen der SED beitraten.)
Der jüdische Anarchist und Schriftsteller Alexander Berkman (1870-1936) unterstützte anfangs die Bolschewisten. Doch die Folgen der Oktoberrevolution, die er aus eigener Anschauung sah, desillusionierten ihn. Die brutale Unterdrückung des Aufstands von Kronstadt führte endgültig zum Bruch, er zog nach Frankreich. 1923 schrieb er die prophetischen Sätze:
Kronstadt ist von großer historischer Bedeutsamkeit. Es läutete dem Bolschewismus mit seiner Parteidiktatur, verruchten Zentralisation, dem Tscheka-terrorismus und den bürokratischen Kasten die Totenglocke. Es traf die kommunistische Autokratie ins Herz. Zugleich gab es den intelligenten und ehrlichen Denkern von Europa und Amerika den Anstoß zu einer kritischen Prüfung der bolschewistischen Theorie und Praxis. Es zerstörte die bolschewistische Fabel, dass der kommunistische Staat die »Regierung der Arbeiter und Bauern« sei.
Was will ich damit sagen? Zur Freiheit des Denkens – selbstverständlich auch des Glaubens – als Grundlage eigenverantwortlichen Handelns gehört schlicht die Möglichkeit, sich umfassend über alles nur denkbar Mögliche informieren zu dürfen. Freiheit ist nicht der anmaßende Besitz allumfassender Wahrheit oder die Einbildung, die Geschichtsgesetze erkannt und damit das Rätsel der Weltgeschichte gelöst zu haben, sondern in dem großen, weltweiten Angebot der Möglichkeiten herumirren und damit eben suchen und finden zu dürfen. Dann könnte theoretisch jeder, wie schon der »Alte Fritz« sagte, nach seiner Fasson selig werden. Jeder darf also in einer offenen Gesellschaft nach dem Stein der Weisen, nach der Weltformel oder nach was auch immer suchen. Nur finden darf man nichts, was zum Beispiel einen Ausschließlichkeitsanspruch erhebt. Freilich, da die Demokratie eine Kompromissgesellschaft darstellt, die auch ganz gut funktioniert, wenn nicht zu viele faule Kompromisse geschlossen werden, sehe ich das im gesellschaftspolitischen Bereich völlig ein, doch auf religiösem Sektor hört der Spaß rasch auf, wenn jemand lediglich daran festhält, was in den Zehn Geboten steht: Ich bin der Herr, Dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. / Du sollst an EINEN Gott glauben und IHN ALLEIN anbeten.
Wer dies heute beherzigt und sich offen dazu bekennt, wird schnell als Fundamentalist abgestempelt. Die modernen marxistisch grundierten Gutmenschen akzeptieren großzügig die Religionen im Plural, obwohl sie ja hinterhältig mit Ludwig Feuerbach glauben, - ich sage ausdrücklich »glauben«! - dass die Götter nur Projektionen des menschlichen Wesens seien. Selbst wenn es so wäre, er-gäbe sich das folgende Problem, das wir mittlerweile in allen modernen Indu-striestaaten schon haben, doch wohl nachdrücklich in Deutschland.
Wenn wir keine Nation mehr sein wollen oder dürfen, wenn wir unsere Geschichte nur noch auf Auschwitz reduzieren lassen, wenn wir unsere abendländisch-christliche Identität aufgeben, die in der jüdischen wie griechisch-römi-schen Kultur wurzelt, werden wir immer charakterloser, ob wir es wollen oder nicht.
Treffendes dazu schrieb mein Freund und Kollege Ulrich Schacht bereits im Jahre 2005 dazu: So hat der einst führende Linksextremist der sogenannten Frankfurter Sponti-Szene - ein zelluloid-überführter Gewalttäter gegen den demokratischen Rechtsstaat und Arafat-Applaudierer auf antiisraelischem PLO-Terrain -, der heutige Außenminister der Republik Joseph Fischer, »Auschwitz« mehrfach zum Gründungsmythos der Bundesrepublik Deutschland erklärt. Solche definitorische Umwidmung des größten politischen Schandflecks der deutschen Geschichte in einen kollektive Identität stiftenden Mythos ist im Kern natürlich nichts anderes als Ausfluss eines sadistischen Charakters und auf so absurde Weise böse, dass es nicht ohne öffentlichen Widerspruch geblieben ist…
Ein Mensch also, der ohne eigene Prägung allen Kulturen, Ideologien und Religionen gegenüber grenzenlos offen sein will, dem der linke Multi-Kulti-Brei schmeckt – was hat so ein Mensch noch für eine innere Verfassung, welche Identität? Toleranz ist ebenso wenig eine Einbahnstraße wie die immerzu eingeforderte Kompromissbereitschaft. Nein, es gibt nicht nur Grenzen, es gibt sogar Bereiche, wo der einzelne Mensch im Prinzip keine Kompromisse eingehen darf, weil er hier nicht nur seine Identität, sondern gleichzeitig seine persönliche Freiheit auf dem Spiel steht.
Das begriff ich, als ich 1971 das erste Mal wegen »staatsfeindlicher Hetze« in der Stasi-Untersuchungshaft war. Deshalb möchte ich es an einem Beispiel anschaulich machen: Der Vernehmer - Leutnant Donat - war raffiniert, soll heißen: psychologisch geschult. Nach dem Schock der Verhaftung und einer qualvollen Woche Einzelhaft baute er am ersten Vernehmungstag, nachdem er erst vergebens Zigarette und Kaffee angeboten hatte, ich aber dann in einen mir über den Tisch gerollten Apfel biss, durch lockeres Erzählen die Angstschwelle langsam und sicher ab. Er erzählte viel von sich, von seinem Vater, seinen Lehrern und fragte nur scheinbar beiläufig nach meinem Vater, nach meinen Lehrern, um dann zu vorgerückter Stunde sogar über das SED-Zentralorgan »Neues Deutschland« zu spotten, wofür Andere erst ins Gefängnis gekommen waren. Noch immer staunend und wieder hoffnungsvoll aß man anschließend in der Zelle erstmals sein Abendbrot mit Appetit, schlief tief befriedigt ein, wurde in dieser Nacht auch nicht aus dem Schlaf gerissen, wie zuvor üblich und freute sich schon auf den nächsten Tag, weil er zum Abschied gesagt hatte: »Wir sehen uns morgen wieder.«
Der nächste Morgen begann freundlich, man durfte sich sofort auf einen Polsterstuhl an einen Tisch vor seinem Schreibtisch setzen. Der Vernehmer sagte, dass er ein kleines Protokoll vom gestrigen Gespräch angefertigt habe, legte es vor mich hin und bat freundlich, es in Ruhe durchzulesen und jede einzelne Seite zu unterschreiben. Aha, dachte es in einem, da kann ja nur ein Tonband mitgelaufen sein, aber als ich den in »Frage« und »Antwort« aufgegliederten Text las, war sofort zu erfassen, dass das keine Umgangssprache vom Tonband war, sondern eine krude Mischung aus bürokratischer und juristischer Sprache. Es war schwer, wenn nicht gar unmöglich, darin das lockere Gespräch vom Vortag wieder zu erkennen, so dass ich tief Luft holte und noch ziemlich schüchtern zu sagen wagte: »Oh, das… das kann ich aber nicht unterschreiben…«
So rasch wie unerwartet sprang der freundliche Vernehmer auf, pflanzte sich, die Hände in die Hüften gestützt, vor mich hin und schrie aus Leibeskräften: »Wolln Sie damit sagen, dass ich lüge?!« In solch einer herbeigeführten Situation, in dem einen nur Filmszenen über die Nazizeit durch den Kopf schossen, schreckte fast jeder zusammen und unterschrieb schnell, um das »harmonische« Verhältnis nicht zu gefährden. Warum ich jedoch nicht unterschrieb, kann ich nicht sagen, weil einem kaum Zeit zur Überlegung blieb. Er beorderte jedenfalls sofort den Läufer per Telefon, und als dieser schon in der Tür stand, schrie er mich geifernd an: »Faust, wir lassen Sie schmoren bis Sie schwarz werden. Sie kommen noch auf den Knien gekrochen und sagen uns Dinge, nach denen wir gar nicht gefragt hatten. Raus jetzt!«
So, das war nur das nötige Vorspiel; das Wesentliche kommt noch: Nach 14 Tagen »Schmoren« in der Einzelzelle stand ich wieder im Vernehmerzimmer. Mit drohendem Unterton fragte er: »So! Wolln Se jetzt unterschreiben?« Ich blieb standhaft, obwohl mir die Knie zitterten, und sagte kleinlaut »Nein«. Er plusterte sich auf und befahl mir, mich an den Tisch vor seinem Schreibtisch zu setzen. Er knallte mir das Protokoll unter die Augen und sagte barsch: »So, jetzt gehen wir den Text mal durch. Jetzt will ich genau wissen, was hier nicht der Wahrheit entsprechen soll!« Daraufhin ließ ich ihn wissen, dass ich diese merkwürdige Sprache nicht verstehe, dass ich unser Gespräch darin nicht wiedererkennen könne. Darauf schrie er wieder künstlich wütend: »So! Was erkennen Sie denn nicht wieder? Wie würden Sie es denn ausdrücken?!« Und als ich ihm ein Beispiel nannte, donnerte er los: »Das steht doch da, nur in anderen Worten ausgedrückt!« Da wagte ich immerhin zu erwidern: »Dann unterschreiben Sie es doch selber! Das ist Ihre Sprache, aber nicht meine!«
Erst geraume Zeit darauf erkannte ich, dass mir hier ganz spontan eine durchaus kluge Erkenntnis eingefallen war, woher auch immer sie gekommen sein mag, nämlich dass man, wenn man seine Individualität, seine Freiheit, seine subjektive Wahrheit, also seine Identität verteidigen will, keinesfalls mit einer anderen, fremden Sprache auch nur den geringsten Kompromisse eingehen darf. Und dennoch ging ich dem versierten Vernehmer erst einmal auf den Leim, denn wir kämpften anschließend den ganzen Tag um jedes Wort, jede Silbe, jedes Satzzeichen. Jede kleinste Veränderung am Text musste von beiden jeweils abgezeichnet werden. Es war mühsam, aber ich war erst einmal froh, doch einiges berichtigen, in meine Sprache übersetzen zu können, bis ich ein paar Tage darauf mit Entsetzen begriff, dass ich einer Selbstbelastung auf Raten verfallen war.
Nun verlangte ich einen Rechtsanwalt. »Einen Rechtsanwalt?!« brüllte er mich an. »Da könn´ Se mal nachfragen, wenn Ihr Ermittlungsverfahren abgeschlossen ist!« Ich tat erstaunt: »Ach, das ist ja interessant! Ernst Thälmann bekam zu seinem vorbereiteten Prozess acht Anwälte von den Nazis zugelassen, darunter sogar aus dem Ausland!« Darauf schrie er dieses Mal tatsächlich erbost zurück: »Sie Würmchen, Sie! Sie wolln sich doch nicht mit Ernst Thälmann vergleichen, Sie! Sie!« Das war sie unverblümt – die Sprache der Macht, der ich entkommen wollte. Dem hätte Henryk Bereska freilich noch hinzuzufügen: Der Eingesperrte will nur raus aus dem Gewahrsam. An die Probleme mit der Freiheit denkt er nicht.
In jeder Diktatur – gleich welcher Einfärbung – ist deshalb der Kampf um die Gedanken- und Gewissensfreiheit zugleich mit dem gewaltlosen Widerstand ge-gen die geistige, psychische und physische Einengung verbunden, der jedoch die Diktatoren und ihre Helfershelfer schnell zur Gewaltanwendung greifen lässt, vor allem dann mit Sicherheit, wenn es keine Zeugen gibt, wenn sie ihre Schandtaten vor aller Öffentlichkeit verbergen können. Selbst wenn sie sich ihre eigenen Gesetze nach der Logik ihrer allein gerechtfertigten Ideologie geschaffen haben, die sie in ihrem Tun legitimieren sollte, wurden sie von Skrupel geplagt, so dass sie sich veranlasst sahen, zu lügen, zu fälschen und zu verbergen. Als selbst der kluge und gebildete Terrorist und Massenmörder Leo Trotzki in Ungnade gefallen war, konnte man zwar noch viele Jahre wegen Trotzkismus in Gefängnissen und Lagern verschwinden oder sogar hingerichtet werden, aber Trotzki als Person hat es eigentlich nie gegeben. Auf allen Fotos aus jener Zeit, wo er neben Lenin stand oder auf Gruppenfotos zu sehen war, wurde er wegretuschiert; aus alle Bibliotheken ließ man seine Schriften entfernen. Selbst im westlichen Wurmfortsatz des Gulag-Regimes, in der DDR, wurden sämtliche Bücher, Fotos und sonstige Zeugnisse sofort aus allen öffentlichen Räumen und Bibliotheken entfernt, wenn ein Politiker, Wissenschaftler, Schriftsteller oder sonstiger Künstler in den Westen abgedriftet oder aus politischen Gründen ins Gefängnis gekommen war. Nur im Gefängnis, wo die Polizei dümmer war, als es die Polizei eigentlich erlaubte, konnte man mitunter Bücher ausleihen, für die man zuvor erst ins Gefängnis gesteckt worden war.1
Von Frankreich aus konnte der Schriftsteller Michel Tournier beobachten: In einem Land, das Dichter einsperrt oder ins Exil treibt, müssen zwangsläufig auch die Hausfrauen vor den Läden Schlange stehen. Freiheit und Wirtschaft hängen ebenso eng zusammen wie Kapitalismus und Wohlstand, wie Größenwahn und Krise. Und möge sie uns jetzt und in Zukunft noch so bedrücken, das Ende einer offenen Gesellschaft, die man kapitalistisch nennt, ist nicht voraussehbar, das bleibt stets ein offenes Geheimnis. Das Ende einer abgeschotteten Diktatur ist hingegen immer absehbar, auch wenn man keinen genauen Zeitpunkt und ebenso wenig voraussagen kann, ob eine solche zwanghaft zusammengehaltene Inzuchtgesellschaft lautlos in sich zusammen fällt oder nach einer Explosion oder einem Bürgerkrieg im eigenen Blut erstickt.
Bereits 1974 konnte der ins Exil getriebene Dissident Alexander Solschenizyn in einem Interview sagen: Ich bin ein Optimist von Geburt an, und ich kann mein Exil nicht als endgültig betrachten. Ich habe das Gefühl, dass ich in einigen Jahren nach Russland zurückkehren werde. Und siehe: Zwanzig Jahre darauf war er wieder in seiner russischen Heimat. Alexander Solschenizyn gehörte zu denen, die ziemlich genau wussten, was kommt, ohne Kartenleger oder Prophet zu sein, sondern weil seine Wahrnehmungsfähigkeit besonders gut ausgeprägt war, auch weil er begriffen hatte, dass die Linie, die Gut und Böse trennt, nicht zwischen Staaten, nicht zwischen Klassen und nicht zwischen Parteien verläuft, sondern quer durch jedes Menschenherz.
Solche aus bitterster Erfahrung gewonnenen Erkenntnisse führten mich zu der befreienden Einsicht, dass wir unsere Natur, die Gutes und Böses einschließt, nicht verändern können, dass jeder Versuch, den »neuen Menschen« zu schaffen, im Verbrechen endet. Diese bittere Lektion sollten wir allesamt aus dem 20. Jahrhundert gelernt haben, sollte man meinen, aber da es kein Ende der Geschichte gibt, keine Gesetzmäßigkeit der Gleichheit und Gleichzeitigkeit zu erkennen ist, gibt es auch keine Übereinkunft aller Menschen in der Erkenntnis der Phänomene. Der weitere Streit in uns wie außerhalb ist immer auch vorprogrammiert, auch derjenige, der bis zur Gewalt und Katastrophe eskaliert. Was wir selber versuchen können, ist, sich möglichst immer in der Balance zu halten, was nur möglich ist, wenn man sich seiner bösen, destruktiven, machtheischenden, rechthaberischen, vorteilsgierigen Gedanken, Triebe, Gelüste und Ansätze bewusst wird, sie nicht schamhaft verdrängt, sondern beichtet, und sei es nur sich selber. Dann erst lassen sie sich eventuell zügeln und beherrscht oder transformiert einsetzen, etwa so, wie es schon Karl Kraus empfahl: Hass muss produktiv machen, sonst ist es gescheiter, gleich zu lieben.
Wo lange schon die Freiheit des Denkens, basierend auf einem freien Willen und in der Folge die Möglichkeit, die Ergebnisse dieses Denkens unzensiert zu kommunizieren, gegeben ist, herrscht kaum Tyrannei, sondern vor allem Wohlstand. Verblasst jedoch bei den Bürgern und denen, die gar keine sein wollen, die Erinnerung an überwundene Armut und Tyrannei, werden Demokratie und Wohlstand als selbstverständlich hingenommen, dreist ohne Gegenleistung eingefordert, dann verfällt das Wertebewusstsein der Freiheit. Gleichgültigkeit, Resignation, Zynismus sowie Sehnsucht nach einer »starken Hand«, nach utopischer Gleichheit, nach revolutionären Lösungen, nach einfachen Welterklärungsmodellen nehmen zu. Der Konsum der Warenwelt wird nicht mehr als Ne-benprodukt der Gedankenfreiheit verstanden, sondern die Verdinglichung aller Naturen wird zum Hauptobjekt des Fühlens und Denkens, bis solches zu Überdruss, Verzweiflung und zur Erkenntnis des angeblichen Konsum-Terrors führt, der wiederum zu eingeschränkten Gedanken und zur Gefühlsarmut verleiten muss.
Das kann man auch Teufelskreis nennen, deren Auslöser und Nutznießer zugleich die Linken sind, die zwar auf ein beeindruckendes Theoriegebäude zurückgreifen, wie der Spiegel-Redakteur Jan Fleischhauer schrieb, aber fast allen linken Theoretikern lässt sich bei manchmal sogar vorhandener Sprach- und Redegewandtheit, (wenn man nicht gerade an ihren Ayatollah vom Starnberger See denkt) nachsagen, dass ihnen vor allem dieses fehlt: Wahrnehmungsfähigkeit und Demut. Sie interessiert »Wirklichkeit« kaum, weder philosophisch noch sonst wie, denn sie leben vom Glauben an ihre angeblich soziologischen oder sonstigen geisteswissenschaftlichen Konstrukte, die stets die Welt verbessern, den Menschen veredeln und alle Welt belehren wollen. Wer links ist, so Fleischhauer, lebt in dem schönen Bewusstsein, im Recht zu sein, ja, einfach immer recht zu haben. Linke müssen sich in Deutschland für ihre Ansichten nicht wirklich rechtfertigen. Sie haben ihre Meinung weitgehend durchgesetzt, nicht im Volk, das störrisch an seinen Vorurteilen festhängt. Aber in den tonangebenden Kreisen, also da, wo sie sich vorzugsweise aufhalten.
Ich habe mich von Anfang an in diesen linken Kreisen, zu denen ich mich nach meiner Übersiedlung 1976 eigentlich hingezogen fühlte, unwohl und unfrei gefühlt. Unsere Erfahrungen mit dem real existierenden Sozialismus interessierte sie kaum, wir sollten nun für den richtigen streiten. Lediglich mit Dissidenten und Aussteigern aus ihren eigenen zumeist linksextremen Reihen wie Klaus Rainer Röhl, Gerd Koehnen, Manfred Wilke, Klaus Schroeder, Jochen Staadt oder Hans Christoph Buch konnte ich mich geistig anfreunden.
Der russische Dissident und Philosoph Alexander Sinowjew, der einige Jahre in München lebte, sah wiederum aus seiner Sicht, was die westliche Freiheit im Wesentlichen ebenfalls bedeutet, nämlich dass der Mensch in vielen lebenswichtigen Situationen sich selbst überlassen ist, weshalb Gefühle wie Ratlosigkeit, Niedergeschlagenheit und Verlassenheit ein weit verbreitetes Phänomen darstellen.
Ja, Freiheit gibt es nicht zum Nulltarif. Wo jeder gern frei und möglichst ungebunden leben will und kann, vergrößert sich automatisch der Abstand zum Nächsten, so dass Nestwärme sich verringert und Kälte zunimmt. Andererseits verhelfen Menschenrechte und Freiheit auch dazu, sich seiner eigenen Meinung, wenn man sich denn eine erarbeitet hat, zu vergewissern, indem man im Prinzip ohne Angst mit Hinz und Kunz reden und sich zusätzlich über alle Medien und Kommunikationsquellen in den Streit der Meinungen einlassen kann, um sie sich infrage stellen oder bestätigen zu lassen. Auch das verhilft zu Reife und Bildung. Das ist nur ein winziger Aspekt dieser längst durchschauten Kausalität. Und auch die Warnung Benjamin Franklins sollte Beachtung finden: Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren.
Der erste Bundesbeauftragte der Stasi-Unterlagen, Joachim Gauck, erkannte treffend: Jede neu gewonnene Freiheit erscheint dem Menschen manchmal als unerträgliche Last. Es gibt ein Leiden an der Freiheit, gefolgt von der tiefen Sehnsucht nach dem Paradies, ob religiöser oder politischer Natur. Das machte den Kommunismus so verführerisch: Er überträgt die Vision vom Reich Gottes ins Politische, dann saugt er Glaubenssubstanz vom Menschen. Die Kommunisten wollten religiösen Glauben nicht. Sie ersetzten ihn durch üblen Aberglauben und brachten Millionen von Menschen um ihre Würde und um ihr Leben.
Wer in eine Diktatur hineinwächst, selbst wenn er gegen sie erzogen wurde, hat dennoch irgendwie von ihr eine Prägung erhalten, und sei es, dass er ihr widerstand, um schließlich mit Heinrich Heine zu begreifen, dass die Freiheit eine Kerkerblume ist. Ich neige dazu, meinen von der Unfreiheit geprägten, zur Unselbständigkeit verdammten Landsleuten, also jenen, die bis zu Wahltagen vor 1990 nichts anzukreuzen hatten, sondern nur den Wahlschein zu falten brauchten und so wesentlicher Entscheidungsmöglichkeiten entwöhnt wurden, mildernde Umstände zu gewähren. Ja, ich weiß, das klingt anmaßend und überheblich. Was habe ich schon zu gewähren?
Doch wer sich anmaßt, vor seinen Landsleuten aufzutreten, gibt auch Meinungen ab, fällt mehr oder weniger Urteile, die zwar menschlich und somit unvollkommen und daher zumindest unbequem sein können. Wer antritt, es allem und allen Recht zu machen, jedem nach dem Munde zu reden, sollte Politiker werden, aber kein Philosoph oder Künstler. Nicht nur der Schriftsteller oder Wissenschaftler, sondern jeder muss die Freiheit haben, alles zu sagen, damit Politiker und Bürokraten sich nicht die Freiheit nehmen, alles zu tun. Dennoch muss es erlaubt sein, die an sich harmlosen Gutmenschen, die ja nicht nur unentwegt der Glaube an eine größere und bessere Zukunft umtreibt, sondern die ja auch viele Steuermittel für ihre Glaubensgrundsätze einsetzen, mit Aldous Huxley als die mächtigsten Feinde gegenwärtiger Freiheit zu bezeichnen. So wie sich Sozialismus und Freiheit einander ausschließen, so auch der Glaube an ein Geschichts-Happy-End und eine Religion, die auch tatsächlich diesen Namen verdient.
Religion kann zwar tröstend wirken, besonders beim zeitlichen Ende uns nahestehender Personen, doch zumeist will sie uns zügeln und unser Gewissen schärfen. Allein schon der Begriff »Gewissen« kam im offiziellen Sprachgebrauch der sozialistischen Staaten kaum vor. Im Dialektischen Materialismus spiegelte das Gewissen nur den wandelbaren Gesellschaftszustand wider, der sich aus wechselnden materiellen Produktionsverhältnissen erkläre. Da die Materie, die einzige Wirklichkeit, sich ständig verändere, gäbe es auch keine sittlichen Maßstäbe, die absolut zu setzen seien. Marx wörtlich: Ein Demokrat hat ein anderes Gewissen als ein Monarchist, ein Besitzender ein anderes Gewissen als ein Besitzloser, ein Denkender ein anderes als ein Gedankenloser(...) Das Gewissen der Privilegierten ist eben ein privilegiertes Gewissen.
Das klingt zwar nach dem ersten Hören durchaus attraktiv, birgt aber die typisch teuflische Raffinesse in sich, die Marx auszeichnet. Wenn man seine gewissenlosen Gedanken weiter verfolgt, kann man nur zu der absurden Ansicht gelangen, dass es da noch viele soziale Schichten, Berufsgruppen und Interessenvereine oder Parteien gibt, deren Gewissen man gegeneinander klassenkämpferisch ausspielen könnte, so dass dieser Begriff »Gewissen« am Ende zu einer sinnlosen Vokabel verkommt. Was das Gewissen aber ist, mit dessen Begriff Marx herum jongliert, wird jedoch nirgendwo erklärt, geschweige denn überzeugend. Hätte Marx anstatt des Gewissens die Begriffe »Bewusstsein« oder »Sprache« eingesetzt, dann könnte man ihn schon ernst nehmen. Die Freiheit im Gedanken, so Georg Wilhelm Friedrich Hegel, hat nur den reinen Gedanken zu ihrer Wahrheit, die ohne die Erfüllung des Lebens ist; und ist also auch nur der Begriff der Freiheit, nicht die lebendige Freiheit selbst.
Ich möchte nicht allein mit Hegel oder Immanuel Kant kontern, für den das Gewissen das Bewusstsein eines inneren Gerichtshofes im Menschen ist. Für ihn hat jeder Mensch, gleich welcher Herkunft, welchen Berufes, welcher sozialen Stellung, welcher Kultur und welcher Privilegien auch immer, ein Gewissen und findet sich durch einen inneren Richter beobachtet, bedroht und überhaupt im Respekt gehalten, und diese über die Gesetze in ihm wachende Gewalt ist nicht etwas, was er sich selbst macht, sondern es ist seinem Wesen einverleibt.
Während Marx nur die Welt, die es nötig hätte, verändern wollte, vor allem mit seiner Lieblingsvokabel »vernichten«, die er schon in seinen Abituraufsatz sechs-mal eingebaut hatte, versuchten Denker wie Martin Heidegger dem Gewissen philosophisch einen Sinn abzugewinnen. Für ihn war das Gewissen nicht eine innere Stimme, die auf etwas Weltliches hin orientiert ist, sondern ihm war das Gewissen etwas, was unser Dasein in Aufmerksamkeit versetzt, indem es ruft und aufrüttelt. Zwar ruft uns das Gewissen, aber es ruft uns nicht etwas zu, das zu tun oder zu befolgen wäre, sondern es ruft lediglich besorgt auf. Und da es uns nichts Bestimmtes zuruft, erfolgt sein Ruf als Schweigen. Solche Stille zwingt das Selbst eigens in die Verschwiegenheit und unterbricht das gewöhnliche Geräusch der Alltäglichkeit. Obwohl der Ruf des Gewissens inhaltsleer ist, wird sich die gerufene Person der allgemeinen Struktur seiner Existenz bewusst, die sich auf nichts Bestimmtes bezieht.
Heidegger konnte für den Charakter des Rufs resümieren, er sei ein vorrufender Rückruf, denn er stelle das Dasein vor die Möglichkeit, sich selbst zu ergreifen, er rufe zurück in die Geworfenheit und bringe das Dasein dazu, sich seines Personseins bewusst zu werden und erschlösse so auch das Schuldigsein. Das rechte Hören auf den Ruf verstand er als ein Seinkönnen, und dies sei hörig seiner eigensten Existenzmöglichkeit gegenüber. Das besagt, das Dasein versteht nicht nur, was es explizit bedeutet, eine Person zu sein, sondern es ändert auch seinen Selbstbezug so, dass es die Verantwortung für seine Person zu übernehmen bereit ist. Damit wird deutlich, dass das Gewissen nicht die verinnerlichte Stimme gewisser Zugehörigkeiten, Besitzverhältnisse oder gesellschaftlicher In-stitutionen sein kann, im Gegenteil, wie oft kommt es vor, dass sich die »Gewissensentscheidung« dann gegen anerkannte Autoritäten oder Institutionen wendet.
Wen würde hier nicht Martin Luther einfallen, der 1521 auf dem Reichstag zu Worms erscheinen und zu seinen ketzerischen Schriften Stellung nehmen musste. Er beschloss seine Rede bekanntlich mit den Worten: Und da mein Gewissen in den Worten Gottes gefangen ist, kann und will ich nichts widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen. Aber was hülfe alle Gewissens- und Gedankenfreiheit, wenn nicht eine dritte, nämlich die wichtigste Stütze dazu käme, denn die Gedankenfreiheit, die dürften wir wohl haben, nur die Gedanken, wo sind sie? Sie fliegen vorbei, wie nächtliche Schatten. / Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. / Es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei.
Immer wenn ich dieses Lied höre, überschwemmen mich meine Emotionen. Es kommt automatisch die Erinnerung an 742 Tage Einzelhaft hoch. Aber es ist keinesfalls Selbstmitleid, das sich hier vordrängt, sondern eine tiefe Dankbarkeit gegenüber den einfachen Strophen eines Liedes, dessen Verfasser unbekannt ist, aber es gibt wahrscheinlich außerhalb der Bibelpsalmen keine bessere Hymne für Menschen, die sich unschuldig eingesperrt empfinden: Und sperrt man mich ein in finstere Kerker, / das alles, das sind vergebliche Werke. / Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken / und Mauern entzwei, die Gedanken sind frei!
Kein Mensch, der das nicht erlebt hat, kann die Kraft verspüren, die einem zuströmt, wenn irgendeine raue Stimme dieses Lied anstimmt, selbst auf die Gefahr hin, anschließend von einem Wärter oder »Erzieher« in Uniform zusammengeschlagen zu werden. Nur im äußersten Kontrast kann wohl die Sehnsucht, emotional wie auf der sprachlich-rationalen Ebene, so tief empfunden werden, das sie nicht nur tröstet, sondern ermutigt, ja eigentümlich frei macht. So möchte ich jetzt am liebsten Goethes »Faust« zitieren: Im Vorgefühl von solchen hohen Glück / Genieß ich jetzt den höchsten Augenblick.
Aber das reimt sich nicht recht zum Thema »Freiheit, die ich meine«, so dass ich meine Seele zum Glück nicht dem Teufel verschreiben musste. Aber die Teufel stecken überall, mit Vorliebe bekanntlich im Detail. Mich hat das Lied von den freien Gedanken verführt, ich muss noch einmal ansetzen: Aber was hülfe alle Gewissens- und Gedankenfreiheit, wenn nicht eine dritte, nämlich die wichtigste Stütze dazu käme, die schon Paulus im 1. Korinther-Brief vor Augen hatte: Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.
Was jeder weiß: Einige Menschen können schön und ausgefeilt reden. Alles was sie sagen klingt absolut korrekt. Trotzdem können ihre Worte nicht unser Verständnis, geschweige denn unser Herz erreichen, wenn es nicht aus Liebe geschieht. Ohne Liebe klingt alles nur wie eine gesetzliche Belehrung. Das Thema wird unversehens zweitrangig, selbst wenn das Thema Sie eigentlich brennend interessiert. Ein liebloser Vortrag ist nicht nur eine Zumutung, sondern ein schweres Vergehen, vor allem, wenn man viele Menschen enttäuscht, deren kostbare Lebenszeit keiner zu vergeuden hat, und sei es nur für eine Stunde. Von Martin Luther stammt bekanntlich das von Paulus inspirierte Paradoxon: Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.
Dieses so auf den Punkt gebrachte Problem unserer Freiheit im christlich-abendländischen Kontext, um es so pathetisch wie verkürzt zu sagen, wird nie dank unserer eigenen Kraft und Vernunft, auf die wir uns oft so viel einbilden, aufzulösen sein, auch wenn wir es hin- und her interpretieren wollten.
Sehr verehrte Damen und Herren, ich war so frei, mich über Ihre Köpfe zu erheben, mich vor Ihnen zu positionieren und Ihre Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen. Das ist die eine Seite. Die andere: Ich habe viele Tage nachgedacht, habe auf vieles Private verzichtet, lange an dieser Rede gefeilt, mich zum Sklaven dieser Sätze und Botschaften gemacht, um Sie nicht zu enttäuschen, um Ihnen etwas zu bieten, was Ihnen nützen könnte. Eine ganz andere Frage ist es freilich, ob das, was ich für nützlich halte, auch so bei Ihnen angekommen ist. Ich bedanke mich artig für Ihre Geduld.
1 Siehe auch Gerald Zschorsch: »Glaubt bloß nicht, dass ich traurig bin«
(Vortrag im Dresdner Stadtmuseum am 12. Mai 2009)